Mehr Schatten als Licht?
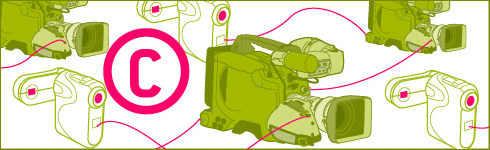
Im Branchenportrait Film geht es um die Arbeitsbedingungen von Kreativschaffenden bei der Produktion von Spiel- und Dokumentarfilmen. Es untersucht, in welcher finanziellen und sozialen Situation sich Urheberinnen und Urheber und andere Kreativschaffende in dieser Branche befinden. Es geht dabei aber auch um die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Filmförderung, die unterschiedlichen Interessen der Branchenverbände und um klassische und neue Modelle zur Finanzierung und dem Vertrieb von Filmen. Wer hat welche Rechte an einem Film? Kann ein Filmurheber damit seinen Lebensunterhalt verdienen? Wie sieht es mit Zweitverwertungsrechten aus? Ist das Urheberrecht überhaupt noch ein geeignetes Instrument zur Regulierung und Durchsetzung der Interessen der Kreativschaffenden in dieser Branche?
Seit die Bilder laufen lernten, ist der Spielfilm mit realen und fiktiven Geschichten nicht nur eine künstlerische Ausdrucksform, sondern auch immer Spiegel der sozialen und politischen Realität. Wird der Film in der breiten Masse der Zuschauerinnen und Zuschauer nach wie vor als Kulturgut wahrgenommen, so stellt er heute zunehmend ein Wirtschaftsgut dar. Die Filmwirtschaft setzt in Deutschland nicht nur Milliarden um, sondern ist auch ein wichtiger Auftraggeber und Arbeitgeber für viele Kreativschaffende. Dabei geht es den Branchenverbänden und der öffentlichen Hand in erster Linie um die Förderung wirtschaftlich erfolgreicher Filme. Die Förderung des Films als Kulturgut und die Sicherung des Filmerbes sind bislang dagegen eher die ungeliebten Stiefkinder, wenn es um die Verteilung der finanziellen Mittel geht. Aktuell steht einmal wieder die Novellierung des Filmförderungsgesetzes an, das regelt, welche Filmgenres in welcher Höhe gefördert werden sollen. Doch bereits jetzt ist abzusehen, dass sich die grundsätzliche Orientierung der Förderpolitik nicht ändern wird. Die Fokussierung der Filmförderung auf kommerziell erfolgreiche Filme erschwert die Arbeitsbedingungen von Kreativschaffenden in weniger erfolgreichen aber dennoch oftmals hochwertigen Filmproduktionen zusätzlich.
Kein Kassenschlager: Dokumentarfilm
Auch das Genre des Dokumentarfilms wird im Branchenportrait unter die Lupe genommen. Aufgrund des Formats und der spezifischen Themen sind Dokumentarfilme nur in den seltensten Fällen Kassenschlager. Kritischer Journalismus und aufwändig recherchierte Informationen sind aber nicht nur Nachweis von Qualität und der Erfüllung des Programmauftrags vieler Sender, sondern ein Tummelplatz von Autoren, Kameraleuten, Cuttern oder Regisseuren. Doch können Kreativschaffende damit überleben? Wie ist die Bezahlung? Gibt es eine ausreichende soziale Absicherung?
Das Branchenportrait Film untersucht die Arbeitsbedingungen 2.0. Neben der rasanten technischen Entwicklung durch die Digitalisierung, den konkreten Ausgestaltungen von Arbeitsverträgen, der finanziellen Absicherung bei Arbeitslosigkeit spielt auch das Problem der gesetzlichen Mindestruhezeit eine wichtige Rolle. Eine der Kernfragen der Untersuchung dreht sich um urheberrechtliche Aspekte im Rahmen der Abtretung von Nutzungsrechten in Arbeitsverträgen. Aber auch Fragen der Sicherung des Filmerbes und dem damit einhergehenden Umgang mit Lizenzen, Lizenzpaketen und alternativen Lizenzmodellen wie Creative Commons werden untersucht.
Youtube und Online-Verleih statt Kino?
Durch die digitale Revolution werden klassische Distributions- und Vertriebsmodelle grundsätzlich in Frage gestellt. Die Erstellung von Laienfilmen, semiprofessionellen Werken oder auch aufwendigeren Produktionen ist aufgrund der technischen Entwicklung und dem einfachen Zugang zu den nötigen technischen Hilfsmitteln inzwischen nahezu jedem möglich. Welchen Einfluss haben Video-on-demand-Angebote, Online-Videoplattformen wie YouTube, Tauschbörsen und Torrent-Tracker auf die Verwertung der Filme und die Verdienstmöglichkeiten der Urheber und der Kreativen? Welche neuen Verwertungs- und Vertriebsmodelle entwickeln sich gerade beispielsweise durch Direktvertrieb im Internet oder durch Werbefinanzierung?
Zwischen Traumjob und Hartz IV
Die Berufsbilder in der Filmbranche sind vielfältig. Ob Schauspieler, Drehbuchautor, Beleuchter, Cutter, Kameramann, Tonmeister, Regisseur, Filmarchitekt oder Komparse – viele dieser Arbeiten sind für Laien und auch für Profis zumindest am Anfang Traumjobs. Mit der eigenen Leidenschaft und Kreativität Geld zu verdienen und sich ein Stück weit im Glanz des roten Teppichs und der Berühmtheit von Stars und Sternchen zu sonnen, ist dabei eine wichtige sekundäre Motivation für einen Einstieg in die Branche. Allerdings, und dies im gilt im wahrsten Sinn des Wortes, gerade hier gibt es oft mehr Schatten als Licht, wenn es um die Arbeitsbedingungen und den Verdienst geht.
Arbeitskämpfe sind in der deutschen Filmbranche nahezu unbekannt. In jüngster Zeit gab es erste gemeinsame Aktionen der Beschäftigten, um ihre Arbeitssituation zu verbessern. Der wochenlange Streik der Drehbuchautoren in Hollywood mag dabei als Beispiel gedient haben. Dabei ging es um die stärkere Beteiligung am Gewinn durch die Vermarktung der Nutzungsrechte und dem Online-Verkauf der Werke. Die Verwertungsrechte für neue „unbekannte Nutzungsarten“ sollen nun auch in Deutschland vielfach und per se durch die Urheber an ihre Auftraggeber abgetreten werden. Wie können jedoch die Urheber an den Einnahmen beteiligt werden. Zentrale Frage dabei ist, welche Organisationsformen zur kollektiven Wahrnehmung der Interessen von Filmschaffenden dabei geeignete Modelle für die Zukunft sein können: Organisation nach Berufsgruppen, unter dem Dach der Gewerkschaft Verdi oder gibt es alternative Modelle?
Quellen
Übersicht: Berufsverbände für Film- und Fernsehschaffende
Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. (SPIO): Schlüsseldaten Filmwirtschaft 2007
Entwurf: Fünftes Gesetz zur Änderung des Filmförderungsgesetzes (PDF, 330 KB)






Was sagen Sie dazu?