Dirk Brengelmann: Die Fragmentierung des Netzes ist eine der großen Gefahren
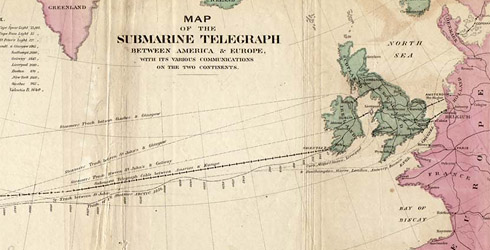
Die Süddeutsche Zeitung berichtete, der Posten des Sonderbeauftragten sei zum einen als eine Antwort auf die Ausspähaffäre geschaffen worden. Zum anderen seien die Diplomaten schon länger bemüht, das Thema Cyber-Politik nicht an andere Ressorts zu verlieren. So wurde bereits 2011 im Auswärtigen Amt ein Koordinierungsstab für Cyber-Außenpolitik eingerichtet. Das US-Außenministerium hat seit 2011 einen Cyber-Beauftragten. Dirk Brengelmann, der Sonderbeauftragte für Cyber-Außenpolitik des Auswärtigen Amts, erklärt, was er macht und wieso sein Job wichtig ist.
iRights.info: Herr Brengelmann, was ist Cyber-Außenpolitik?

Dirk Brengelmann ist seit August 2013 Sonderbeauftragter für Cyber-Außenpolitik des Auswärtigen Amts. Davor war er bei der NATO, in den Botschaften in Port-au-Prince, London und Washington, im Kanzleramt sowie als Referatsleiter Sicherheits- und Verteidigungspolitik im AA tätig. Foto: DPA.
Dirk Brengelmann: Wenn es um Cyber-Außenpolitik geht, dann geht es um das Thema Internet und Menschenrechte, um Privacy und Datenschutz. Das hat Auswirkungen auf unsere Firmen, auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf die Agenda in der Europäischen Union.
iRights.info: Warum gibt es Ihren Job?
Dirk Brengelmann: Schon nach ein paar Tagen hier in diesem Amt merkt man, dass Cyber-Außenpolitik im Auswärtigen Amt ein Querschnittsthema ist, das eine Reihe von Arbeitsbereichen betrifft. Eine meiner Aufgaben ist es, diese verschiedenen Stränge zusammen zu halten. Das liegt auch an den verschiedenen Akteuren bei dem Thema. Das war etwas, was ich sehr schnell lernen musste.
Es ist eben kein klassisches Spiel zwischen Nationalstaaten, sondern ein Konzert mit sehr vielen verschiedenen Musikanten: Nichtregierungsorganisationen, Staaten, Wirtschaft, Wissenschaft. Ich komme aus einem Hintergrund, wo man eher unter Staaten verhandelt. Dieser Aspekt war für mich eine neue Erfahrung.
iRights.info: Stichwort Wirtschaft: Deutschland ist eine führende Exportnation. Das Wirtschaftsministerium hat daher traditionell einen sehr starken Einfluss bei internationalen Verhandlungen zur Internet-Regulierung. Gibt es Ihre Position deshalb, um dem Wirtschaftsministerium etwas entgegenzusetzen?
Dirk Brengelmann: Das ist nicht fokussiert auf ein Ministerium. Wir stimmen uns innerhalb der Bundesregierung sehr eng ab. Dies gilt für das Wirtschaftsministerium genauso wie für das Innenministerium, das Kanzleramt, oder auch das Justizministerium, etwa wenn es um Datenschutz geht. Ich spreche häufig mit den Kollegen, die im Innen- und Wirtschaftsministerium auf meiner Ebene tätig sind. Ich habe bisher keinerlei Probleme gehabt und ich sehe auch keine kommen.
iRights.info: Wissen Sie immer, mit wem Sie in den anderen Ministerien sprechen müssen?
Dirk Brengelmann: Ja.
iRights.info: Glauben Sie, dass die neue Bundesregierung diesen Bereich stärken wird? Wird es möglicherweise zwischen den Ministerien eine stärkere Kooperation geben?
Dirk Brengelmann: Ich glaube, das Themenfeld als solches braucht keine Aufwertung mehr, das ist einfach da und für jeden erkennbar. Die Frage, wie das strukturell bekleidet wird, ist für mich eine zweite Frage.
iRights.info: Ob es also einen Internetminister geben wird?
Dirk Brengelmann: Darüber entscheiden andere.
iRights.info: Haben Sie eine Aufgabenliste für die nächsten Jahre? Und wenn ja, was steht drauf?
Dirk Brengelmann: Das, was ich mache, wird im Augenblick zu einem Gutteil von den Auswirkungen der sogenannten Spähaffäre bestimmt, auch wenn ich nicht derjenige bin, der in Washington die Gespräche mit den Geheimdiensten führt. Da sind Dinge in Bewegung geraten, die sonst vielleicht nicht so schnell in Bewegung geraten wären. Ob Internet-Regulierung oder Privatsphäre, ob Menschenrechte oder Datenschutz – wie darüber in der EU verhandelt wird, und wie unsere Firmen darauf reagieren: Überall können Sie sehen, die Ausspähvorwürfe bestimmen das Thema.
Dieses neue Momentum, diese neue Bewegung, wird die Debatte mindestens ein bis zwei Jahre lang bestimmen. Keiner kann vorhersagen, wo wir beim Thema Internetregulierung in einem Jahr sein werden. Die Dinge sind in Bewegung geraten, jetzt muss man versuchen, sie zu gestalten. Aber zu sagen, in zwei Jahren will ich, was das anbelangt, unbedingt da oder dort sein, das wäre vermessen.
iRights.info: Stellen Sie sich vor, ich bin Unternehmer und im Multi-Stakeholder-Prozess engagiert, weil ich irgendwie mit Internet zu tun habe. Jetzt lese ich von der NSA, vom GCHQ, aber zum Beispiel auch davon, dass der BND angeblich Informationen geliefert hat, die dabei geholfen haben, die extrem fortgeschrittene Schadsoftware Stuxnet zu entwickeln, die in iranische Atomanlagen eingeschleust wurde. Kann eine Regierung in diesem Multi-Stakeholder-Prozess noch ein Partner der Zusammenarbeit sein?
Dirk Brengelmann: Ich habe bisher nicht das Gefühl, dass man uns mit mangelndem Vertrauen entgegentritt. Und ich habe es bisher nicht erlebt, dass man mich gefragt hat: „Können wir überhaupt noch mit euch reden?“
iRights.info: Dann drehen wir das mal um. Wir wissen inzwischen genau, dass bestimmte Firmen sehr eng mit Nachrichtendiensten kooperieren. Warum glauben Sie, dass Sie in diesem Multi-Stakeholder-Prozess, der historisch etwas ganz Neues ist, mit Unternehmen vertrauensvoll zusammenarbeiten können?
Dirk Brengelmann: Können? Müssen! Wir müssen mit allen, die in diesem Bereich wichtig sind, im Gespräch bleiben. Wir sind mit den Regierungen im Gespräch, und da gibt es ja nicht wenige kritische Kandidaten. Wir sind mit allen Vertretern der Zivilgesellschaft im Gespräch. Und wenn wir das weiter entwickeln wollen, müssen wir auch mit allen Firmen im Gespräch sein. Die Dinge sind so im Fluss, dass man vorsichtig mit Schlussfolgerungen sein sollte, wem man wann, wo und wie trauen kann.
iRights.info: Hat Sie in diesem ganzen Skandal, in dieser Entwicklung etwas überrascht? Oder waren das meist Informationen, die Sie bereits geahnt hatten?
Dirk Brengelmann: Ich gestehe zu, dass ich auch gelegentlich überrascht war.
iRights.info: Die Bundesregierung muss abschätzen, welche Gefahren bei Außenpolitik, Wirtschaftspolitik und -spionage bestehen. Wie wichtig ist es, dass die Geheimdienste möglichst viel wissen? Wo muss man nachrüsten, um beim nächsten Mal nicht so überrascht zu sein?
(Brengelmann lacht.)
iRights.info: Oder, um es wie Herr Dobrindt zu formulieren: Cyber-Supermacht Europa als Gegenpol zu China und den USA.
Dirk Brengelmann: Es gibt jetzt viele Forderungen wie: Wir müssen mehr bei der Hardware machen, wir müssen mehr bei der Software machen und so weiter. Es gibt das Thema „Digitale Agenda“ bei den Beratungen der EU, die Vorschläge der EU Kommission. Was davon am Ende wirklich möglich ist, ist eine andere Frage. Ja, wir müssen mehr tun, aber wir sind natürlich gleichzeitig eine Exportnation, die im Welthandel tätig ist. Bei aller Liebe zu nationalen Initiativen müssen wir immer sehen, wie Firmen, die wir hier auf unserem Boden haben, zum Beispiel SAP, weiter tätig bleiben können. Da gibt es sehr unterschiedliche Interessenlagen.
iRights.info: Was halten Sie dann von Forderungen nach einer Nationalisierung des Internets, nach „EU-Clouds“, „Deutschland-Clouds“ oder „Deutschland-Mail“?
Dirk Brengelmann: Bisher ist es so, dass die Firmen ihren Kunden bestimmte Möglichkeiten anbieten und die Kunden dann entscheiden, ob sie das wahrnehmen wollen. Das ist erst einmal eine autonome Entscheidung des Konsumenten. Man kann bestimmte Entwicklungen fördern, aber es ist eine ganz andere Diskussion, ob man bestimmte Dinge reglementieren will. In den Diskussionen kommt das Thema Fragmentierung des Netzes sehr schnell auf, dass also viele Länder nationale Regeln aufstellen wollen. Viele sagen, dass es bereits stattfindet.
Ich glaube, das ist eine der großen Gefahren aus dem, was wir jetzt erlebt haben: dass solche Neigungen weiter befördert werden, aber auch gelegentlich als Argument für andere Dinge dienen – denen, die das Internet stärker im Griff haben wollen, um Kontrolle auszuüben.
iRights.info: Die Nationalisierung wird durchaus als Möglichkeit gesehen, Staaten – und damit dem Bürger als Souverän – wieder Einfluss zu verschaffen.
Dirk Brengelmann: Natürlich sind auch die Nationalstaaten Player in diesem sogenannten Multi-Stakeholder-Prozess. Bei den Vereinten Nationen gibt es die sogenannte Group of Governmental Experts, die darüber berät, wie das Völkerrecht, das internationale Recht, zur Anwendung kommen kann. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass es zur Anwendung kommt, dass man also kein neues Völkerrecht entwickeln muss. Aber unter dem Dach des Völkerrechts gibt es möglicherweise doch Bedarf für Normen und Verhaltensregeln, die auch für den Cyberspace gelten – darüber beraten wir zum Beispiel in den Vereinten Nationen, wo wir gemeinsam mit Brasilien einen Resolutionsentwurf zum Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter eingebracht haben.
iRights.info: Sehen Sie die Gefahr, dass bestimmte Staaten, in denen Bürger- und Menschenrechte nicht gut geschützt sind, darauf drängen, eine stärkere Kontrolle über das Internet und seine Regulierung und Verwaltung zu bekommen?
Dirk Brengelmann: Wir nehmen durchaus wahr, dass in bestimmten Ländern die Zügel weiter angezogen werden.
iRights.info: Es gibt die Arbeitsgruppen bei den Vereinten Nationen und woanders, aber da geht es nicht um einen neuen, internationalen Vertrag. Sehen Sie den kommen?
Dirk Brengelmann: Wir haben genug Möglichkeiten, Normen zu entwickeln. Wir haben einen Vertrag im Bereich Cybercrime, die so genannte Budapest Convention, die den Vorteil hat, dass auch Staaten außerhalb des Europarats diesem Vertrag beitreten können. Die Forderung nach einem Vertrag unter dem Stichwort Code of Conduct, etwa von den Russen und Chinesen, ist schon länger im Umlauf. Ich sehe ihn bisher nicht kommen und wir unterstützen das auch nicht. Die Group of Governmental Experts macht gute Arbeit; wir arbeiten dort gerade an einer Resolution im Rahmen der Vereinten Nationen, die das indossieren wird und die hoffentlich die Neuauflage einer solchen Gruppe zulässt, sodass man diesen Prozess weiter voran treiben kann.
iRights.info: Normalerweise rechnet man bei Vertragsverhandlungen nicht in Monaten, sondern in Jahren und Jahrzehnten.
Dirk Brengelmann: Das ist ein Punkt, warum wir sagen: Die Dinge sind so im Fluss, dass ein Vertrag als Instrument nicht wirklich dafür geeignet ist.
iRights.info: Es heißt, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Welche Möglichkeiten haben Sie, als Vertreter des Auswärtigen Amts und der Bundesregierung, Einfluss auf Partner auszuüben, mit deren Verhalten Sie nicht einverstanden sind?
Dirk Brengelmann: Es gibt auf der Staatenebene einen relativ kleinen Kreis von Leuten, die dieses Geschäft betreiben, in der Civic Society ist es ein großer Kreis. Das heißt, die informellen Strippen unter den Staaten sind relativ kurz. Man ist sehr schnell in Kontakt miteinander, man kann sehr schnell Signale untereinander austauschen und sich über die richtigen Schritte verständigen.
iRights.info: Dann noch zu einem ganz konkreten Thema: Wie wichtig ist Netzneutralität?
Dirk Brengelmann: Die Federführung liegt beim Bundeswirtschaftsministerium. Aber für mich ist klar, dass man das nicht nur als Wirtschaftsthema, sondern als Menschenrechtsthema sehen sollte. Wenn es um den menschenrechtlichen Aspekt geht, teile ich die Forderung nach Netzneutralität.
Dieser Text ist auch im Magazin „Das Netz – Jahresrückblick Netzpolitik 2013-2014“ erschienen. Sie können das Heft für 14,90 EUR bei iRights.Media bestellen. „Das Netz – Jahresrückblick Netzpolitik 2013-2014“ gibt es auch als E-Book, zum Beispiel bei Amazon*, beim Apple iBook-Store* (Affiliate-Link) oder bei Beam.






1 Kommentar
1 fukami am 16. Dezember, 2013 um 09:58
Leider übersieht Herr Brengelmann, dass fast alle Multistakeholder-Ansätze scheitern, weil zum einen zuviel Industrie und zuwenig Zivilgesellschaft dabei ist – oder wie bei der Netzneutralitätsdebatte die ganze Zeit die Zivilgesellschaft dabei ist, aber bei den entscheidenden Meetings nicht mehr. Da hätte ich ja gerne Vorschläge, wie bei solchen Ansätzen sichergestellt werden kann, dass es nicht zu einer Ungleichgewichtung kommt.
Dann halte ich die Gefahr, dass viele Länder ihre eigenen Regeln aufstellen, für ein Phantom. Selbstverständlich gibt es soziale und politische Normen, die sich im Umgang mit dem Netz widerspiegeln *müssen*. Wo es bei den unverbrüchlichen Menschenrechten noch einen Sinn ergibt, auf die Einhaltung digital wie analog zu pochen, so ist das bei anderen Normen schon noch etwas defiziler. Wenn das anders ist, passieren Dinge wie die zum Datenschutz auf EU-Ebene, wo die untersten Standards auf die übertragen werden, die höhere Standards haben.
Die Regeln zu “Cybercrime” sind aus meiner Sicht unter aller Kanone und auch da zeigt sich, dass sich eben leider das durchsetzt, was am einfachsten ist – nämlich über Strafe statt über Prävention nachzudenken. Genau das ist aber das, was für mehr Sicherheit in der Informationsgesellschaft dient, nicht die Schaffung neuer Straftatbestände wie Hackertools-Paragraphen und Definitionen digitaler Waffen.
Was sagen Sie dazu?