Auf halbem Weg stehengeblieben: EU-Parlament diskutiert Biopiraterie
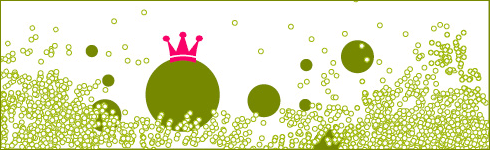
Genetische Ressourcen (GR) sind ein Teil der biologischen Vielfalt. Neben den Ökosystemen auf der einen und den Arten auf der anderen Seite sind sie die kleinste Einheit, die aber die Information über Baupläne der Individuen oder auch einzelner Hormone und Eiweiße in sich tragen. Seit rund drei Jahrzehnten sind diese genetischen Ressourcen umkämpfter Bestandteil der globalen Industrie geworden – unter anderem für Saatgut, Pharma, Kosmetika und mehr. Patente und andere geistige Eigentumsrechte werden genutzt, um die genetischen Ressourcen zu privatisieren und zu kommerzialisieren.
Daher ist es wichtig und richtig, dass sich das EU-Parlament in dieser Woche (am 14. und 15. Januar) auf Initiative des Committee on Development mit der Bedeutung genetischer Ressourcen und dem Themenkomplex Biopiraterie beschäftigt und einen Entschließungsantrag zum Thema diskutieren wird. Auch der explizite Bezug zu den Millennium Development Goals und der Armutsbekämpfung ist wichtig, denn soziale Gerechtigkeit ist eines der drei wichtigen Ziele der Konvention über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention, auch Convention on Biological Diversity – CBD), einem der wichtigsten Abkommen, wenn es darum geht, wie mit genetischen Ressourcen umgegangen werden und wer Zugang zu ihnen haben soll.
Die Rolle und Bedeutung geistiger Eigentumsrechte – seien es Patente auf Gene, das Sortenschutzrecht oder auch geographische Herkunftsangaben – sind nicht zu unterschätzen. Aber auch nicht das Konfliktpotential: Die einen argumentieren, sie sichern Innovationen und Märkte ab, die anderen halten derartige Rechte für Ausbeutung und ethisch verwerflich.
Vor allem die Ärmsten sind betroffen
In vielen internationalen Abkommen wird über den Umgang mit genetischen Ressourcen diskutiert und verhandelt. Ihr Schutz, Erhalt und die nachhaltige Nutzung sind beispielsweise das zentrale Anliegen der Konvention über die biologische Vielfalt. Gleichzeitig haben Debatten um geistige Eigentumsrechte, mit denen die Verwendung von genetischen Ressourcen reglementiert werden sollen, Fahrt aufgenommen – spätestens seit 1991, dem Mittelpunkt der damaligen GATT-Verhandlungen.
Gene werden patentiert, Heilpflanzen privatisiert und mit geistigen Eigentumsrechten belegt; Pflanzensorten in der Landwirtschaft dürfen von den Landwirten zum Teil schon nicht mehr kostenlos nachgebaut werden. Nichtregierungsorganisationen beklagen schon seit vielen Jahren, dass diese geistigen Eigentumsrechte sozial ungerecht sind und vor allem Menschen in Entwicklungsländern besonders hart treffen.
Wie im Entschließungsantrag des EU-Parlaments formuliert, sind es vor allem die Ärmsten, die unter geistigen Eigentumsrechten an genetischen Ressourcen leiden. Neben den schon geschilderten Auswirkungen kritisieren die EntwicklungspolitikerInnen, dass der Zugang zu patentierten Medikamenten schwierig ist und die traditionellen Rechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften missachtet werden.
Über 80 Prozent der jährlich weltweit vergebenen Patente sind im Besitz von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Nordamerika, Europa oder Japan haben. Somit fließt auch der überwiegende Anteil von Lizenzgebühren in diese Länder. Nach Schätzungen von ExpertInnen der Weltbank kommen auf die Entwicklungsländer Mehrzahlungen von über 60 Milliarden Euro zu, da sie das TRIPS-Abkommen zu geistigen Eigentumsrechten der Welthandelsorganisation umsetzen müssen – etwa das 1,5fache der gesamten jährlichen öffentlichen Entwicklungshilfe.
Andere Berechnungen kommen zu dem Schluss, dass die sechs größten Industrieländer in Zukunft wegen TRIPS jährliche Mehreinnahmen von etwa 41 Milliarden US-Dollar verbuchen können. Die Folge ist, dass die weniger entwickelten Länder dauerhaft auf Abstand gehalten werden, ihre ökonomische Entwicklung gebremst wird.
Auch die Forschungsabteilung der Deutschen Bank kommt zu dem Schluss, dass immer weniger Unternehmen Saatgut entwickeln, vermarkten und gleichzeitig die dazu passenden Agrarchemikalien produzieren. Diese Konzentration schränkt den Wettbewerb ein, kleinere Unternehmen haben es immer schwerer, sich am Markt zu behaupten.
Vor Gericht stehen Kleinbauern gegen den Global Player Monsanto
Die Auswirkungen geistiger Eigentumsrechte an genetischen Ressourcen und an Saatgut treffen Volkswirtschaften oder Bauern nicht nur finanziell, sondern auch in ihrer konkreten praktischen Arbeit: Für die USA hat das Center for Food Safety rund 100 Fälle von Landwirten dokumentiert, die von Monsanto, dem weltweit dominierenden Hersteller von Saatgut und Agarchemikalien, beschuldigt wurden, Patentrechte der Firma verletzt zu haben. Sie müssen sich nun in gerichtliche Auseinandersetzungen mit einem der größten Konzerne der Welt begeben.
Auch in Deutschland schickt die sogenannte Saatgut-Treuhand-Verwaltungs GmbH Kontrolleure auf die Höfe, um zu überprüfen, dass etwa Kartoffeln nur zum Verzehr verkauft werden und darauf ausdrücklich hingewiesen wird – und nicht als Pflanzware für das kommende Jahr.
Für viele Landwirte, Kleinbauern und -bäuerinnen, indigene Völker und soziale Bewegungen ist es offensichtlich, dass das bestehende System der geistigen Eigentumsrechte nichts mit ökologischer Gerechtigkeit zu tun hat und in der Landwirtschaft nicht anzuwenden ist. Insbesondere diejenigen, die auf verschiedene Sorten von Saatgut angewiesen sind, können die teuren Lizenzgebühren nicht finanzieren. Ihre Anliegen werden durch den Antrag des Europaparlaments gestärkt.
Darüber hinaus stellt sich für viele Menschen noch die ethische Frage: Darf es überhaupt Patente auf Gene, auf Leben, auf Vielfalt geben? Auf Dinge also, die wir ererbt haben, für die unsere Vorgängergenerationen sich schon engagiert haben und in denen sich das Wissen vieler Generationen manifestiert.
Das Europaparlament hat den größeren Zusammenhang aus dem Auge verloren
Eine Möglichkeit, genetische Ressourcen wieder zum Gemeingut werden zu lassen, ist, ähnlich wie bei Software, die Entwicklung einer General Public Licence for Plant Genetic Resources. Auch wäre es möglich, auf nationaler Ebene sogenannte Saatgutfonds einzurichten, die Forschung und Saatgutentwicklung koordinieren und die dazu nötigen Mittel verwalten. Diese Modelle weiter auszuarbeiten und gesellschaftliche Mehrheiten dafür zu gewinnen, ist eine Herausforderung [1] – leider geht der Antrag des Committee überhaupt nicht auf diese Diskussionen ein.
Eine weitere Schwäche des Antrags liegt im institutionellen Kontext begründet. Die ParlamentarierInnen denken in den vorhandenen Bahnen und übersehen dabei den größeren Zusammenhang. Sie fordern, bestehende Abkommen weiterzuentwickeln, die Biodiversitätskonvention zu stärken, das TRIPS-Abkommen der WTO etwas abzumildern und grundsätzlich ein kohärentes System der Politiksteuerung (coherent global governance system) zu schaffen.
Diese Forderungen scheinen logisch, verkennen jedoch, dass die bestehenden Abkommen Ausdruck internationaler Machtgefüge und von Machtpolitik sind. Nicht umsonst ist das Abkommen über indigene Rechte unverbindlich, verlaufen die Zugangs- und Vorteilsverhandlungen der Biodiversitätskonvention seit Jahren im Kreis – während die EU-Kommission zugleich mit Drittstaaten bilaterale Verträge aushandelt, die weit über die Anforderungen des TRIPS hinausgehen und die Partnerländer zwingen, Standards geistiger Eigentumsrechte einzuführen, die die Freiheiten der BäuerInnen, der indigenen Völker oder der PatientInnen weiter einschränken.
Dass Bestimmungen in nationalen Patentgesetzen nicht umgesetzt werden, die dafür sorgen sollen, dass Gesetze eingehalten werden, zeigt, dass es nicht gewünscht ist, geistige Eigentumsrechte so zu regulieren, dass sie einer umfassenden ökonomischen Entwicklung und der Armutsbekämpfung dienen. Dennoch sollte der Antrag des Entwicklungsausschusses des Europaparlaments viele LeserInnen und ZuhörerInnen finden – die kritische Erkenntnis ist schließlich ein wichtiger Schritt hin zu Veränderungen der politischen Bedingungen.
[1] Vgl. hierzu das in Kürze von Agrecol herausgegebene Diskussionspapier von J. Kotschi und G. Kaiser: Open Source für Saatgut. Mehr Info bei AGRECOL e.V. Verein zur Förderung der standortgerechten Landnutzung in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa.

Über den Autor: Gregor Kaiser, promovierter Sozialwissenschaftler und Biologe. Bewirtschaftet u.a. einen Forstbetrieb im Sauerland, www.vielfalt-wald.de.
Für Quellen und weiterführende Literatur empfiehlt sich das Buch „Eigentum und Allmende, Alternativen zu geistigen Eigentumsrechten an genetischen Ressourcen“, erschienen 2012 im Oekom-Verlag, München.






Was sagen Sie dazu?