Urheberrechtliche Aspekte bei kreativer Arbeit
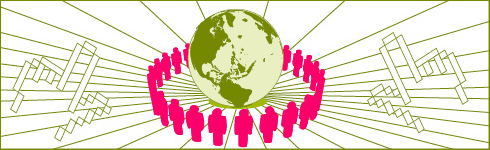
Das Gesetz nennt Kreative Urheber und Urheberrinnen; das Urheberrecht soll ihre rechtlichen Beziehungen zum Werk und ihren Umgang mit den Werken anderer regeln. Es verfolgt bedeutende Ziele: „Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes“, heißt es im Gesetz.
Aber ist das Urheberrecht wirklich noch Spiegel der modernen Kreativgesellschaft? Schützt es die Interessen der Urheberinnen angemessen – seien sie nun ideeller oder materieller Natur? Ist es geeignet, Bloggern, Bastardpoppern, Appropriation Artists ebenso gerecht zu werden wie angestellten Softwareprogrammierern, Bildredakteuren und wissenschaftlichen Hochschulmitarbeitern? Sichert es den freien Journalisten ein angemessenes Auskommen? Und wenn, wie macht es das?
Im Projekt Arbeit 2.0 soll diesen und anderen Fragen aus dem Spannungsfeld zwischen Urheberrecht und kreativem Schaffen nachgegangen werden. Gegenstand des Projektes ist, nicht nur das juristische „sollte“ zu hinterfragen, sondern auch und vor allem das „ist“ zu beschreiben. Arbeit 2.0 heißt Analyse, aber auch und vor allem Information. Denn die Kreativen müssen mit dem Urheberrecht leben und umgehen, sollten also auch darüber informiert sein. Sich zu informieren ist aber nicht leicht, ebenso wenig, das Urheberrecht zu erklären.
Schwierigkeiten bereitet vor allem der Umstand, dass es unter Vorzeichen geschaffen wurde, die heute nicht mehr gelten. Es stammt aus Zeiten, in denen es vorwiegend Profis – wie Filmkonzerne, Verlage oder durch Manager vertretene Musiker – damit zu tun bekamen. Auf den Wandel beim kreativen Schaffen oder die Phänomene des „Web 2.0“ wurde bislang nicht reagiert. Das Urheberrecht ist alles andere als leicht verständlich, es ist keineswegs „nutzerfreundlich“. Im Gegenteil: Es ist eine höchst komplizierte Rechtsmaterie, die selbst Experten häufig nur schwer durchdringen.
Urhebervertrags- und Urheberarbeitsrecht: ein unübersichtliches Feld
Die rechtlichen Rahmenbedingungen von kreativer Arbeit zu analysieren und darzustellen ist schwierig, weil es sich um eine Querschnittsmaterie handelt. Hinzu kommt, dass Teile, wie insbesondere das „Urheberarbeitsrecht“ (das in dieser Form gar nicht existiert), nur sehr lückenhaft, teilweise gar nicht gesetzlich geregelt sind. Das Urheberrechtsgesetz regelt zwar im Prinzip, dass der Urheber ein Urheberrecht erwirbt und welchen Umfang dieses Recht hat. Was man als Musiker, Filmschaffender, freier Journalist oder Aktionskünstler damit anfangen kann, lässt sich dem Gesetz jedoch nur diffus entnehmen.
Über die praktisch meist bedeutendste Frage, wer welche Nutzungsrechte erhält, wenn Musik, Texte, Fotos oder Grafiken im Auftrag oder Angestelltenverhältnis erstellt werden, finden sich kaum rechtliche Bestimmungen. Das sollte eigentlich – und damit erklärt sich die Zurückhaltung des Gesetzgebers – in Verträgen geregelt sein. Was aber, wenn es keine Verträge gibt? Was, wenn die Verträge nur aus allgemeinen Geschäftsbedingungen bestehen, die eine Seite – in der Regel der Auftraggeber (der „Verwerter“) – der anderen zur Bedingung stellt, ohne dass der andere darauf Einfluss hat? Was gilt in Angestelltenverhältnissen, in denen häufig gar keine Vereinbarungen über Nutzungsrechte getroffen werden?
Einer der Grundsätze des Urheberrechts besagt, dass alle Urheber angemessen wirtschaftlich beteiligt werden müssen, wenn ihre Werke von anderen genutzt werden. Jede Urheberin hat ein „Recht auf eine angemessene Vergütung“. Was im Gesetz zunächst gut klingt, ist jedoch in der Praxis vielfach nur bedingt hilfreich. Denn was genau heißt das? Gegenüber wem kann man dieses Recht geltend machen? Und vor allem – unter welchen Umständen? Welche Vergütung ist nicht mehr angemessen? Viel Eindeutiges ist darüber im Gesetz nicht zu finden. Abgesehen davon, dass tarifvertraglich vereinbarte Einkünfte als „angemessen“ fingiert werden, bleiben die meisten praktisch relevanten Fragen offen.
Ein weiteres Beispiel: Schon seit der Urheberrechtsreform im Jahr 1965 gab es den so genannten „Bestseller-Paragrafen“. Eine Regelung, die sinngemäß sagt, dass der Urheber noch einmal Geld bekommen soll, wenn ein anderer mit seinem Werk so viel verdient, dass die ursprünglich vereinbarte Vergütung nicht mehr angemessen erscheint. Es muss zu einem „auffälligen“ Missverhältnis zwischen Ertrag und Honorar gekommen sein. Das klingt aus Sicht des Kreativen erstmal gut; die Früchte die hier versprochen werden, hängen aber sehr hoch. Wie hoch sie hängen, mit anderen Worten, was ein „auffälliges Missverhältnis“ ist, ist schwer zu ermessen. Was wiederum ein Problem ist. Denn allein sich mit ehemaligen, derzeitigen, vielleicht zukünftigen Auftraggebern anzulegen, dazu bedarf es schon einiges. Und wer macht das, ohne einschätzen zu können, ob er Recht hat, ob er Recht bekommt?
Grenzen der Vertragsfreiheit
An dem Beispiel der zwar vertraglich vereinbarten, aber mit gesetzlichen Mitteln korrigierbaren Vergütung zeigt sich, dass man in Verträgen viel, aber nicht alles beliebig regeln kann. Das hat seinen guten Grund. Gerade Verträge, in denen die Nutzung von geschützten Werken wie Texten, Filmbeiträgen oder Übersetzungen geregelt sind, werden meist zwischen Parteien mit ungleichem Kräfteverhältnis geschlossen. Weder der für einen Verlag tätige Übersetzer, noch der freie Journalist oder ein Studiomusiker haben in aller Regel viel Einfluss darauf, was in den Verträgen vereinbart wird. Das betrifft einerseits die Höhe des Honorars, weshalb der Gesetzgeber auch bestimmt hat, dass eine angemessene Vergütung auch dann verlangt werden kann, wenn eine unangemessene Vergütung im Vertrag steht. Das betrifft aber andererseits auch die Reichweite der Rechteeinräumung, beispielsweise, ob Zweitveröffentlichungen in anderen Medien oder Online-Nutzungen neben dem eigentlichen Abdruck gestattet sind. Viele Verwerter operieren hier mit Standardvertragsformularen, auch allgemeine Geschäftsbedingungen genannt.
Auch zu der Frage, was in solchen Standardbedingungen wirksam vereinbart werden kann und was nicht, gibt es gesetzliche Regelungen. Die stehen aber nicht im Urheberrechtsgesetz, sondern im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), also in den „allgemeinen Regeln“ des deutschen Zivilrechts. Solche Regelungsgefüge, bei denen auf eine bestimmte Materie verschiedene Gesetze angewendet werden, sind häufig schwer zu interpretieren. So auch in Bezug auf die Frage, ob die allgemeinen Regelungen des BGB auch für Nutzungsverträge nach dem Urheberrecht gelten und – vor allem – was das in Bezug auf die Frage heißt, wie weit gehend der quasi-machtlose Auftragnehmer akzeptieren muss, was sein Vertragspartner in seine AGB hineinschreibt. Das Gesetz verweist zur Antwort auf solche Fragen gern auf Üblichkeiten, auf „Wesensgehalte“, Kernbereiche und andere schwer ergründliche Aspekte, denen im Projekt Arbeit 2.0 nachgegangen werden soll.
Grenzen selbst schaffen
Ein Thema, das immer wichtiger wird, ist Open Content und Open Source. Dahinter steht die Idee, dass die Urheber ihre Werke selbst vermarkten und selbst bestimmen, wer sie zu welchen Bedingungen nutzen können soll. Creative Commons, die Free Software Foundation und viele andere Institutionen stellen Musterverträge bereit (die so genannten Open-Content- oder Open-Source-Lizenzen), die jeder nutzen kann. Dennoch ist es alles andere als einfach, eine sinnvolle Verwertungsstrategie mit „freien Inhalten“ zu entwickeln, die den eigenen Interessen gerecht wird.
Schon die Wahl der richtigen Lizenzen, die in teils sehr unterschiedlichen Ausprägungen in vielen hundert Varianten zur Verfügung stehen, ist eine Aufgabe, die ernst genommen werden sollte. Denn einen Inhalt, der einmal unter einer Lizenz veröffentlicht wurde, auf eine andere Lizenz umzustellen, ist schwierig, wenn nicht unmöglich. Die Besonderheiten der Lizenzen sind daher von vornherein zu berücksichtigen. Dafür muss man rechtliche Aspekte kennen und einschätzen können, denn Open-Content-Lizenzen sind vor allem vertragliche Konstruktionen.
Der rechtliche Teil der Arbeit 2.0-Untersuchung
Im Rahmen der bei Arbeit 2.0 erstellten Branchenportraits wird sich eine Vielzahl der angesprochenen Fragen stellen. Sie sollen im rechtlichen Teil beantwortet und dabei der Untersuchung der Arbeitsverhältnisse in den ausgewählten Branchen als „allgemeiner Teil“ vorangestellt werden. Das dient dazu, die im Rahmen der Branchenportraits relevanten juristischen Rahmenbedigungen zu erläutern. Der rechtliche Teil mit seiner Zusammenstellung, Aufbereitung und Darstellung der gesetzlichen Vorschriften und Rechtsprechung zu den relevanten Themen soll aber auch hiervon unabhängig als Informationsquelle dienen. Dafür werden vor allem Texte auf der Webseite iRights.info veröffentlicht, aber es wird auch einen Leitfaden zu speziellen urheberrechtlichen Fragen in Wissenschaft und Lehre geben. Solche Aufklärung ist wichtig, damit das Urheberrecht den Arbeitern 2.0 nützen kann. Denn Rechte, die man nicht kennt, werden nicht ausgeübt. Und Pflichten, die man nicht kennt, werden nicht befolgt.
Quellen
Online-Dossier Urheberrecht der Bundeszentrale für politische Bildung
Homepage des Instituts für Urheber- und Medienrecht mit vielen Materialien zum Urheberrecht
Dokumentation der Reform des Urhebervertragsrechts bei Urheberrecht.org
Eintrag in der Wikipedia zum Urhebervertragsrecht
Hucko, Elmar, Das neue Urhebervertragsrecht, Halle/Saale 2002, ISBN 978-3898121576
Berger, Christian; Wündisch, Christian, Handbuch Urhebervertragsrecht, Baden-Baden 2008, ISBN: 978-3832920418






Was sagen Sie dazu?