„Nicht kreativ genug”: Eine Porno-Ente erobert die Schlagzeilen
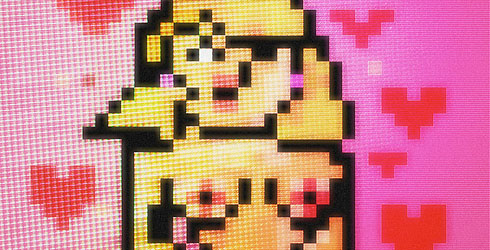
In den letzten Tagen machte eine Meldung die Runde. Der Tenor: Pornofilme seien nicht kreativ genug, um urheberrechtlich geschützt zu sein. In den Schlagzeilen heißt es „Kein Urheberrecht: Pornos fehlt die Schöpfungshöhe”, „Landgericht München spricht Pornos das Urheberrecht ab” oder auch „Primitive Pornos dürfen im Internet getauscht werden”. Man gewinnt den Eindruck, hier sei ein Grundsatzurteil über das Urheberrecht bei Pornos ergangen. Filesharer seien demnach mitunter sogar sicher vor Abmahnungen, wenn sie Pornofilme weiterverteilen.
Tatsächlich aber erging lediglich ein Beschluss (PDF), kein Urteil. Auch haben die Richter des Landgerichts München nicht bewertet, ob Pornofilme urheberrechtlich schutzfähig sind – weder grundsätzlich noch bezogen auf die beiden Filme, um die es konkret ging. Wahrscheinlich haben sich die Richter die Filme nicht einmal angesehen. Vielmehr ist hier nur das deutsche Prozessrecht am Werk.
Schöpfungshöhe nur pauschal behauptet
Die Prozessregeln im Zivilrecht folgen der sogenannten „formellen Wahrheit”. Sie lassen diejenigen Behauptungen als richtig gelten, die der jeweilige Prozessgegner nicht widerlegt oder wenigstens ausdrücklich anzweifelt – jedenfalls, solange die Wahrheit nicht offensichtlich woanders liegt. Im jetzt bekannt gewordenen Fall war das so: Die Frage, ob und wann Pornofilme ausreichende Schöpfungshöhe haben, um urheberrechtlich geschützt zu sein, ist nicht offensichtlich mit „Ja” oder „Nein” oder „sobald …” zu beantworten. Also müssen die Streitenden argumentieren. Je genauer, desto mehr Gewicht hat das Argument.
In diesem Fall hatten die Abmahner nur pauschal behauptet, dass ihre Pornofilme urheberrechtlich schutzfähig seien. Die Abgemahnten argumentierten weniger pauschal dagegen an – indem sie genauere Gründe nannten, die gegen den Urheberschutz sprechen. Die Oberlandesgerichte Hamburg und Düsseldorf haben bereits in den 70er und 80er Jahren entschieden, dass das bloße Abfilmen sexueller Handlungen nicht die für Urheberschutz erforderliche Schöpfungshöhe erreicht.
Abmahner stellten sich tot
Ob ein Film aber möglicherweise über diese „reine Pornografie” hinausgeht und doch Urheberschutz genießt, muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Doch dazu kam es in München gar nicht, weil die Abmahner auf die Gegenargumente der Abgemahnten gar nicht mehr reagiert hatten, obwohl das Gericht von ihnen weitere Angaben verlangt hatte.
Nach dem Prozessrecht müssen die Richter nun unterstellen, dass die bis dahin eingehender argumentierende Seite richtig liegt. Das waren die Abgemahnten, die gesagt hatten, dass der Film „Flexible Beauty” lediglich „sexuelle Vorgänge in primitiver Weise” zeige. Der Beschluss zugunsten der Abgemahnten ist also aus eher formellen Gründen erfolgt, weil die Abmahner sich gewissermaßen „totgestellt” haben – nicht also, weil die Richter den fraglichen Porno wirklich als besonders primitiv oder gestalterisch minderwertig beurteilt hätten. Über die Schutzfähigkeit von Pornofilmen ist also nichts neu entschieden worden, was nicht auch schon die Oberlandesgerichte entschieden hätten. Nicht einmal bezogen auf die beiden Filme „Flexible Beauty” und „Young Passion”.
Laufbildschutz und Fremdenrecht: Es wird kompliziert
Interessanter ist an dem Fall, dass er eine andere rechtliche Frage ins Blickfeld rückt. Die aber ist eher etwas für Jura-Nerds. Neben dem urheberrechtlichen Schutz gibt es in Deutschland noch den Schutz als Laufbild, der ähnlich wie bei einfachen Foto-Schnappschüssen keine Schöpfungshöhe voraussetzt. Dieser „Laufbildschutz” ist der einzige Schutz, der „reiner Pornografie” seit den oben genannten Entscheidungen der Oberlandesgerichte zugebilligt wird.
Das Landgericht München hat auch diesen – dem Urheberrecht ähnlichen – Schutz verneint, weil formelle Voraussetzungen dafür im Verfahren nicht belegt worden waren. So hatten die angeblichen Rechteinhaber ihre Inhaberschaft nicht glaubhaft gemacht, womit es wiederum an der Aktivlegitimation – der Befugnis, den Anspruch geltend zu machen – fehlte.
Zusätzlich hat sich das Gericht aber mit einer sehr speziellen Frage des sogenannten „Fremdenrechts” befasst. Darin ist geregelt, ob und wann ausländische Werke und Leistungen in Deutschland ebenfalls geschützt sind. Das ist nur dann der Fall, wenn das jeweilige Werk oder Laufbild in Deutschland erschienen ist. Der Begriff „Erscheinen” war ursprünglich auf körperliche Vervielfältigungsstücke wie Videos, DVD und so weiter ausgerichtet. Dass die Filme auf diese Weise in Deutschland vertrieben werden, wurde im Verfahren aber offenbar nicht einmal vorgetragen.
Umstritten – und von den Folgen her möglicherweise weitreichend – ist die Frage, ob eine Netz-Veröffentlichung auch als „Erscheinen” im rechtlichen Sinn gelten kann. Damit würde jedes Online-Stellen von Inhalten zugleich ein Erscheinen in allen Ländern der Erde darstellen. Selbst wenn man das annimmt, muss ein entsprechender Dienst jedoch zusätzlich – so zumindest das Landgericht München – auf Nutzer in Deutschland ausgerichtet sein. Auch das haben die Richter nicht als gegeben angesehen.
Fazit
Meldungen wie „Porno nicht kreativ genug, um geschützt zu sein” sind eingängig, machen schnell die Runde, sind aber ganz klar falsch. Wer Pornos per Filesharing tauscht, für den wirkt der „Laufbildschutz” ohnehin fast genauso wie der durchs Urheberrecht. Inhaltlich spricht die Entscheidung ein paar interessante Punkte zum „Erscheinen” von Werken an, die aber sehr speziell sind und Nutzer nicht unbedingt treffen. Das Ergebnis ist eher uninteressant. Die Abmahner haben den Fall vor allem deshalb verloren, weil sie im Verfahren geschlampt und die notwendigen Informationen nicht beigebracht haben.






9 Kommentare
1 Anonym am 3. Juli, 2013 um 16:35
Es mag sich dabei um eine bewährte Taktik handeln: Lieber einen Prozess verlieren, dafür aber ein (Grundsatz-)urteil verhindern. Denn dann würden sich ja alle Abgemahnten darauf berufen wollen. So bleibt weiterhin für jeden Abgemahnten das Risiko, ob er mit dem Mangel an Schöpfungshöhe gehört wird.
2 Mario am 3. Juli, 2013 um 16:43
Schöne Zusammenfassung & Klarstellung trotz dröger Materie. Solche Artikel machen irights.info wertvoll.
3 John Hendrik Weitzmann am 3. Juli, 2013 um 17:44
Das könnte sein, wahrscheinlicher ist aber Desinteresse oder Knauserigkeit der Abmahner, denn die hatten ihre Auskünfte (Namen hinter den IP-Adressen der Filesharer) ja schon bekommen, bevor der jetzige Beschluss erging. Da hat man sich wahrscheinlich einfach die Anwaltskosten gespart und nicht mehr reagiert.
4 Johannes Waldman am 3. Juli, 2013 um 18:05
[entfernt, bitte beim Thema bleiben, d.Red.]
5 Murgi am 4. Juli, 2013 um 22:35
Naja, so ganz stimmt das nicht. Die Richter folgen nicht der Seite, die kreativer argumentiert. Das würde ja heißen, dass das schönste Märchen obsiegt.
Es gilt vielmehr folgendes: Jeder muss die ihm günstigen Tatsachen darlegen und beweisen. Das heißt in diesem Fall, dass die Kläger erstmal angeben mussten, warum ein Schutzrecht vorliegt. Und das ist offensichtlich versäumt worden.
6 John Hendrik Weitzmann am 5. Juli, 2013 um 08:57
Um kreativeres Argumentieren geht es nicht, sondern um eingehenderes. In diesem Falle sind die Abgemahnten, nach dem die Abmahner pauschal Schutzfähigkeit behauptet hatten, ihrer sekundären Darlegungslast nachgekommen und haben eingehend Tatsachen vorgebracht, die gegen die Schutzfähigkeit sprachen. Dies hätten die Abgemahnten möglicherweise relativ leicht – und völlig unkreativ – durch andere Tatsachen (ästhetische Elemente der Filme, Schnitttechnik, was auch immer) überwinden oder zumindest eine eigene Meinungsbildung der Richter erzwingen können. So aber galten die eingehender vorgetragenen und unwidersprochenen Tatsachen als glaubhaft gemacht und damit als formell wahr. Entscheidender war ja offenbar eh, dass die Abmahner nicht einmal ihre Rechteinhaberschaft gegen die Anzweiflungen verteidigt hatten.
7 Schmunzelkunst am 6. Juli, 2013 um 07:40
Bei einem Film, der aus einer Folge von Laufbildern (§ 95 UrhG) besteht, sind die Einzelbilder entweder gar nicht oder nur als einfache Lichtbilder (§ 72) geschützt. Wenn der Schutz gem. § 72 besteht, was bei fotografischen Aufnahmen fast immer der Fall ist, hat der Kameramann die Rechte daran, die er i.d.R. dem Filmhersteller überlässt. Da spielt es m. E. keine Rolle, ob die Bilder in “körperlicher” Form erschienen sind oder nicht. Weiß das jemand genauer?
MfG
Johannes
8 Michael Laube am 14. Juli, 2013 um 01:15
Den Ausführungen kann ich mich nicht anschließen.
Schon die dargelegte Prämisse für die Ausführungen scheint mir unvollständig: »Die Prozessregeln im Zivilrecht folgen der sogenannten „formellen Wahrheit”. Sie lassen diejenigen Behauptungen als richtig gelten, die der jeweilige Prozessgegner nicht widerlegt oder wenigstens ausdrücklich anzweifelt – jedenfalls, solange die Wahrheit nicht offensichtlich woanders liegt.«
Das gilt meines Erachtens nur für Tatsachen und Tatsachenbehauptungen.
Nicht selten verlangen Tatbestände jedoch Wertungen – so zum Beispiel, ob eine gesetzte Frist angemessen ist oder ob ein Film die für Urheberschutz erforderliche Schöpfungshöhe erreicht.
Im Zivilprozess müssen aber die Beteiligten nur die vom Tatbestand geforderten Tatsachen vortragen und die Entscheidung, ob die Wertungen, die der Tatbestand manchmal fordert – also beispielsweise, ob eine gesetzte Frist angemessen war oder ein Video eine persönliche geistige Schöpfung darstellt – dem Gericht überlassen.
Natürlich können sie dabei auch Argumente austauschen und ihre Rechtsansichten darstellen.
Nur aus den Grundsätzen des Zivilprozesses, insbesondere dem Beibringungsgrundsatz, sind sie dazu nicht verpflichtet.
Da mihi factum, dabo tibi ius.
Das Gericht hätte sich deshalb, wenn es meint, dass es auf die Wertung, ob das Video nur Darstellung in “primitivster Weise” enthalte und deshalb keine für den Urheberschutz erforderliche Schöpfungshöhe erreicht, ankommt, das infrage stehende Video anschauen und selbst bewerten müssen.
Insofern hätte das Landgericht die Wertung der Betroffenen nicht nur deshalb übernommen dürfen, weil ihr nicht widersprochen wurde.
Erst wenn es – nach eigener Prüfung – die Wertung inhaltlich teilt, kann es diese Wertung zur Grundlage für die Entscheidung machen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass das Gericht in seiner Begründung überhaupt keinen Sachvortrag der Beteiligten zu diesem Punkt nennt. Hier heißt es nur, dass die Beteiligten vortrugen, dass der Film […] kein Schutz als Filmwerk genieße. Aus welchen Tatsachen das folgt, wird nicht dargestellt.
In den rechtlichen Ausführungen heißt es dann noch: Die Antragsführerin habe die Schutzwürdigkeit des Films […] lediglich pauschal behauptet. Auch auf den substantiierten Sachvortrag der Beteiligten hat sie nichts erwidert. Die Kammer unterstellt daher, dass dessen Sachvortrag zutrifft und der […] Film lediglich sexuelle Vorgänge in primitiver Weise zeigt[…]. Hierfür kann kein Schutz als Filmwerk beansprucht werden.
Was aber die Beteiligten genau substantiiert als Tatsache vorgetragen haben, ist nirgends in der Begründung zu lesen, obwohl der Tatsachenvortrag, soweit er für die Schlüssigkeit der Entscheidung des Gerichts notwendig ist, auch in der Begründung angegeben werden muss.
Die Beteiligten mögen möglicherweise Tatsachen vorgetragen haben. So mögen sie, vereinfacht dargestellt, vorgetragen haben, dass der Film nur einen Mann und eine Frau zeigt, die Sex miteinander in den verschiedensten Stellungen haben. Das ist in der Tat eine Tatsache.
Aber erst aus einer Wertung dieser durch das Gericht ergibt sich, ob der Film lediglich sexuelle Vorgänge in primitiver Weise zeigt und ob er deshalb kein Schutz als Filmwerk beanspruchen kann.
Was hätte die Antragsführerin denn hier vortragen sollen?
Dass sie aus denselben Szenen, die die Beteiligten genannt haben, zu ganz anderen Bewertungen kommt?
Dass sie der Ansicht ist, die genannten Szenen zwar Mann und Frau zeigen, die miteinander in verschiedenen Stellungen Sex haben, allerdings handele sich dabei nicht nur um die Darstellung lediglich sexueller Vorgänge in primitiver Weise, sondern um etwas mit Schöpfungshöhe?
Dass sie deshalb meint, dass der Film Schutz als Filmwerk verdient?
Das sind keine Tatsachen.
Das sind Wertungen und Rechtsansichten.
Im Übrigen stellt sich natürlich die Frage, ob das Gericht seiner Hinweispflicht genügend nachgekommen ist, wenn es den Beschluss darauf stützt, dass der Kläger einen Vortrag der Betroffenen nicht widersprochen hat.
Es könnte dann ja sein, dass der Kläger diesen Gesichtspunkt übersehen oder für unerheblich gehalten hat.
Im Rahmen der Hinweispflicht genügt es eben nicht, nur pauschal die Gelegenheit zu geben, zu allem, was der Gegner vorgebracht hat, Stellung nehmen zu können.
Wenn eine Partei die Relevanz eines Vortrags der Gegenpartei aus einem von ihr übersehenen Gesichtspunkt nicht erkennt, muss das Gericht, wenn es das erkennt, einen entsprechenden Hinweis erteilen. Es kann sich dann nicht damit begnügen, dass die Partei ja Gelegenheit zur Stellungnahme hatte und von selbst den Gesichtspunkt, den sie übersehen hat, erkennen hätte können.
Insofern ist schon klar – und überraschend ist das für ein bayerisches Gericht nicht wirklich – warum das Gericht so entschieden hat.
Was sagen Sie dazu?