Linksfraktion zum Urhebervertragsrecht: Richtiger Ansatz, inhaltlich streitbar
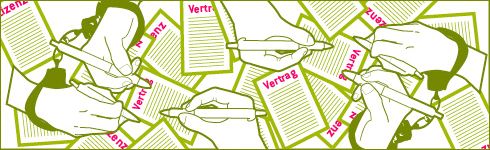
In der aktuellen Urheberrechtsdebatte macht die Bundestagsfraktion der Linken mit ihrem Gesetzesentwurf zu einer Neugestaltung des Urhebervertragsrechts vom 21.Mai (siehe den Eintrag im iRights-Blog) den nächsten Schritt zu einer konkreten Auseinandersetzung. Damit gibt es endlich etwas Greifbares in der viel zu aufgeheizten und polemisch geführten Debatte. Ein begrüßenswerter Vorstoß, aber auch ebenso überraschend.
Nun wirft mit der Linken eine Partei den Hut in den Ring, deren Annäherung an das Thema ich deutlich weniger pragmatisch erwartet hätte. Noch Anfang Mai wurden auf einer Veranstaltung in Berlin („Kreatives Schaffen in der digitalen Welt“) denkbare kreativwirtschaftliche Vergütungsmodelle der Zukunft vorgestellt und die Frage nach dem gesellschaftlichen Wert von Kultur gestellt. Hochinteressant, sicher. Aber eben auch Themen, die unter der Überschrift „Wir müssen unsere Welt ganz neu denken“ ebenso gut aufgehoben wären und bei denen sich niemand wirklich vorstellen kann, sie innerhalb der nächsten Jahre Gesetz werden zu sehen. Luc Jochimsen räumte etwa ein, sich zu diesem Thema noch positionieren zu müssen. Wenig Konkretes also.
Was blieb, war aber auch die Erkenntnis, dass sich derzeit ganze Generationen von Heranwachsenden ob der viel kritisierten Abmahnpraktiken von unserer Rechtsordnung entfernen. Vielleicht hat auch die anschauliche Darstellung der Zwänge einer gemeinsamen europäischen Rechtsordnung durch Till Kreutzer von iRights.info den Ausschlag gegeben, sich dem Problem nun in kleinen, aber praktikablen Schritten und auf nationaler Ebene zu nähern. Denn genau das tut die Fraktion der Linken nun. Ihr Vorschlag ist pragmatisch und lebensnah und diskutabel. Für revolutionäre Ansätze sprach Till Kreutzer von einer schwierigen „politischen Großwetterlage“.
Eine klitzekleine Lösung
Um in der Terminologie des als „kleine Lösung“ bezeichneten ersten Korbes der Urheberrechtsreform zu bleiben, könnte man diesen Vorschlag nun als „klitzekleine Lösung“ bezeichnen. Handelt es sich doch mehr um einen Aufruf zur Nachbesserung des Urhebervertragsrechts. Es soll ausgebügelt werden, was 2002 einfach nicht gut umgesetzt wurde und entgegen der damaligen Regelungsintention auch nicht zu einer besseren Vergütungssituation von Urhebern in der Breite geführt hat.
Dies war freilich bereits damals abzusehen. Denn dass die Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln nicht zwingend sind und damit Verwerter deutlich aus der Pflicht nehmen, musste sich nicht erst herausstellen, sondern erschließt sich bereits aus dem Gesetz. Hier ist es nun wiederum die aufgeheizte „öffentliche Großwetterlage“, die zumindest einer kleinen Reform die Chance gibt. Zwischen den Zeilen gelesen hat auch die Bundesministerin der Justiz in ihrem am 30. Mai in der FAZ veröffentlichten Beitrag Redebereitschaft für einen solchen Ansatz gezeigt, während sie einer echten Reform die Absage erteilt hat.
Für mich ist dies, wenn auch inhaltlich streitbar, zumindest der richtige Ansatz. Sicher, drängende Probleme wie die Legalisierung von Mashups durch eine Fair-Use-artige Regelung werden praktisch ausgeklammert. Und doch gibt es anerkanntermaßen Handlungsbedarf und Punkte, die auch national angegangen werden können – allen voran die angemessene Vergütung.
Und damit bin ich bei der inhaltlichen Auseinandersetzung. Hier möchte ich auf wenige Punkte eingehen, die den Entwurf für mich prägen. Im Sinne des Vorgenannten soll die Vergütungssituation von Urhebern verbessert werden:
- Die Linke schlägt vor, Buy-Out-Verträge zu verhindern, indem die Möglichkeit zur Einräumung von Nutzungsrechten auf einzelne Nutzungsarten nach Paragraph 31 I beschränkt wird.
- In Paragraph 32 II soll zur besseren Definition der Angemessenheit („…was üblicher- und redlicherweise zu leisten ist.“) der Begriff der Redlichkeit einer Vergütung definiert werden.
- Das Justizministerium soll ermächtigt werden, gemeinsame Vergütungsregeln für Branchen selbständig festzulegen oder das Ergebnis einer Schlichtung nach Paragraph 36a für verbindlich zu erklären, wenn eine entsprechende Einigung von Urhebern und Verwertern nicht gelingt.
Zum Buy-out und zum Begriff der Angemessenheit
Dass die Vergütungssituation von Urhebern teilweise prekär ist und verbessert werden muss, wird im Allgemeinen gar nicht bestritten. Hier scheint es auch weitgehend Einigkeit zu geben, dass die ja erst 2002 in das Urhebervertragsrecht eingefügte Sicherung der angemessenen Vergütung bisher nicht den erforderlichen Erfolg gebracht hat. Oftmals übertragen Urheber notgedrungen alle Rechte an einem Werk und werden pauschal und schlecht vergütet. Hier nun nachzubessern und möglicherweise auch einfach die technischen Fehler des Gesetzes auszubügeln ist grundsätzlich ein guter Ansatz.
Dennoch halte ich den Vorschlag, Buy-outs zu verhindern, für den falschen Weg. Sicher, die Idee dahinter ist schlüssig. Der Gedanke ist, dass eine Vergütung eher verhältnismäßig sein wird, wenn der Urheber nicht alle, sondern nur einige Rechte überträgt. Allerdings wird vernachlässigt, dass die Vergütung für eine eingeschränkte Rechtseinräumung auch geringer ausfallen könnte – ein Argument, welches auch in der Debatte vor 2002 schon angeführt wurde.
Die Linke möchte auch erreichen – so zumindest laut Kommentar zum Entwurf (PDF), dass der Urheber mit der neuen Definition von Angemessenheit in Paragraph 32 „an allen Einnahmen eine Beteiligung“ erhält. Für mich verkennt dies die rechtstechnische Stellung der Vorschrift.
Seit 2002 kommt Paragraph 32 die Aufgabe zu, eine angemessene Vergütung bei Vertragsschluss zu gewährleisten – also dafür, dass der Urheber einem Verwerter Nutzungsrechte überträgt. Sicher spielen hierbei die zu erwartenden Einnahmen eine Rolle. Wie erfolgreich das Werk wird und wie viel Geld der Verwerter einnimmt, weiß zu diesem Zeitpunkt jedoch niemand. Die angemessene Vergütung hat also auf den ersten Blick nichts mit dem tatsächlichen Erfolg der Verwertung zu tun.
Ein wichtiger Maßstab für die angemessene Vergütung ist vielmehr, welche und wie viele Rechte übertragen werden, wie lange und wie exklusiv. Hier möchte die Linke nun ansetzen, indem sie diese Möglichkeiten einschränkt. Das löst aber nicht das Problem, sondern provoziert lediglich tendenziell niedrigere Pauschalvergütungen. Das Problem ist doch nicht, dass Urheber umfangreiche Nutzungsrechte abgeben dürfen, sondern dass die Angemessenheit der Vergütung als Maßstab der Gegenleistung nicht klar ist. Insofern würde der Vorschlag die Tarifautonomie der Urheber völlig unangemessen einschränken, ohne den gewünschten Erfolg herzustellen. Oder anders gesagt: die Urheber wären auch mit langen Vertragslaufzeiten und umfassenden Verwertungen deutlich glücklicher, wenn nur das Geld stimmte.
Diesbezüglich nun die vorgeschlagene Definition zur Redlichkeit. Auch dies geht für mich aber am Ziel vorbei. Es stimmt zwar, dass Redlichkeit die Angemessenheit laut Paragraph 32 determiniert. Hier allerdings eine weitere Reihe leerer Rechtsbegriffe einzubringen, schafft bestimmt keine Rechtsicherheit. Vielmehr stellt Paragraph 32 doch bereits klar, dass eine nach Paragraph 36 erstellte gemeinsame Vergütungsregel implizit als angemessen gilt. Und genau darin liegt für mich die Lösung des Problems: Wären die Paragraphen 36 und 36a ein wirksames Instrument zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln, würden sich im Laufe der Zeit Maßstäbe für angemessene Vergütungen für verschiedene Branchen und Werkgattungen entwickeln. Dies war die ursprüngliche Idee des Professorenentwurfs aus dem Jahr 2000, des ersten Entwurf zur Reform 2002, und ist immer noch der hinter dem heutigen Urhebervertragsrecht stehende Mechanismus. Welche Vergütung angemessen ist, sollte sich aus den Branchen heraus und damit harmonisch ergeben, ggf. auch per Rechtsprechung, kann aber keineswegs durch den Gesetzgeber vorgegeben werden.
Dem Mechanismus zur Schaffung gemeinsamer Vergütung mehr Durchschlagskraft zu verleihen, möchte zwar auch die Link mit ihrem Entwurf, aber eben noch zusätzlich! Aus meiner Sicht würde es reichen, sich hierauf zu konzentrieren und Einschränkungen der Vertragsautonomie auszuklammern. Insofern sind die Vorschläge in Bezug auf den Buy-Out, die Definition der Redlichkeit, aber auch die Verkürzung der Schutzfristen nicht zielführend.
Es scheint ein wenig, als wolle man nun auf allen Ebenen ansetzen und traue nach den Erfahrungen der letzten Jahre dem ganzen System zur Sicherung der angemessenen Vergütung nicht mehr. Oder es wird einfach verkannt. Dabei ist diese Systematik einfach und gut, so die denn funktioniert.
Wie oben beschrieben, stellt Paragraph 32 die Vergütung bei Vertragsschluss sicher und im Verhältnis zur Rechtseinräumung und der erwarteten Erlöse. Für ungewöhnlich erfolgreiche Verwertungen im laufenden Vertrag, an denen der Urheber keinen angemessenen Anteil hat, tritt dann aber Paragraph 32a ein. Damit stellen beide Vorschriften auf unterschiedliche Situationen ab. Letzterer ist sozusagen eine Verlaufskontrolle der angemessenen Vergütung und spricht von einer „weiteren angemessenen Beteiligung“. In beiden Fällen ist die Angemessenheit unterstellt, wenn die Vergütung nach einer gemeinsamen Vergütungsregel festgelegt wurde (und eine Beteiligung enthalten ist). Sie kommen dann also gar nicht zum Tragen. Die Möglichkeit zur Aufstellung solcher Gesamtvereinbarungen zwischen Verbänden schafft Paragraph 36, flankiert mit einem Schlichtungsverfahren nach Paragraph 36a. Das Problem und gleichzeitig seine Lösung ist also: Das Ergebnis dieses Verfahrens ist nicht verbindlich!
Dass die angemessene Vergütung zwingend einer (fortlaufenden) Beteiligung an allen Einnahmen aus der Verwertung oder gar an einem unerwarteten Erfolg entsprechen soll, war aber noch nie so gedacht. Pauschalvergütungen, die gerade keine fortwährende Beteiligung bieten, sind doch genauso legitim wie unter Umständen relativ niedrige Vergütungen beispielsweise für unwesentliche Beiträge zum Verwertungserfolg (Beispiel Werbung). Dies muss auch so sein mit Blick auf Abrechnungsanforderungen bei Beteiligungen, die nicht jeder Verwerter leisten kann und die Vielfältigkeit der Branchen und Verwertungssituationen.
Was bleibt, ist aber eine Lücke im System der angemessenen Vergütung für den Fall, dass eine Pauschalvergütung relativ niedrig war für ein erfolgreiches Werk, gleichzeitig aber noch kein Anspruch auf weitere Beteiligung besteht. Hierfür muss nämlich ein auffälliges Missverhältnis vorliegen. Generell ist Paragraph 32a für sich genommen hoch problematisch – allein in Bezug auf die Durchgriffshaftung nach Paragraph 32a II. Dazu jedoch enthält der Entwurf keinerlei Ansätze. Andere Probleme sind wohl schlicht vorrangig.
Zu gemeinsamen Vergütungsregeln
In Bezug auf die gemeinsamen Vergütungsregeln geht der Vorschlag aber in die richtige Richtung. Nach derzeitigem Recht besteht einerseits das Problem, dass Urheber und deren Verbände Schwierigkeiten haben, Verwerter bzw. deren Vertreter an den Verhandlungstisch zu bekommen. Diese können erklären, zur Vertretung nicht ermächtigt zu sein. Und wer will sie dazu verpflichten, es doch zu sein?
Andererseits führt das Verfahren vor der Schlichtungsstelle, welches durchgeführt wird, wenn Verhandlungspartner zwar vorhanden sind, aber keine Einigung erreicht wird, zu keinem verbindlichen Ergebnis. Die Parteien können dem Schlichtungsvorschlag einfach widersprechen mit der Wirkung, dass dieser als nicht angenommen gilt. Mit anderen Worten: ein ganz einfacher Ausweg für jeden Verband, der sich nicht auf Vergütungsregeln festlegen will.
Kein Wunder also, dass nichts erreicht wurde. Die Marschroute muss nun sein, Verwerter wirksam an den Verhandlungstisch zu bringen und ein verbindliches Ergebnis zu erreichen. Hier lautet der erste Ansatz der Linken, dem Justizministerium die Befugnis zur eigenmächtigen Aufstellung von Vergütungsregeln zu geben, wenn sich die Verwerter entziehen. Wohl einen gewissen Widerstand erwartend, heißt es schon im Kommentar dazu: „Typisch Linke?“
Ehrlich gesagt, ja! Das ist viel zu links. Natürlich entzieht sich die Industrie gern Verhandlungen, bei denen es augenscheinlich darum gehen soll, sie schlechter zu stellen. Zwar sehe ich die oft aufgemacht Front zwischen Verwertern und Urhebern gar nicht so klar, wie sie das ganze Urhebervertragsrecht unterstellt. Aber dennoch: Verwerter sind Unternehmen und wollen legitimerweise Geld verdienen. Die Idee, Verwerter per Gesetz zur gemeinschaftlichen Teilnahme an einem Verfahren zu verpflichten und das Problem damit zu lösen wurde schon vor 2002 verworfen Blick auf die negative Koalitionsfreiheit des Artikels 9 GG. Damit bleibt dies ein riesiges Problem. Aber der gemachte Vorschlag klingt nicht nur nach der Drohung mit staatlicher Regulierung. Er widerspricht auch der Grundidee des Urhebervertragsrechts, welches aus dem Markt heraus und damit harmonisch und durch die Teilnehmer selbst zu Lösungen kommen möchte. Der Sinn des Rechtsinstituts der angemessenen Vergütung fußt ja gerade auf der Erkenntnis, dass sich Vergütungsregeln für die Vielzahl der betroffenen Branchen und Nutzungssituationen nicht vorgeben lassen. Auf welcher Grundlage sollte das Ministerium denn zu einer Entscheidung kommen?
Ohne eine Lösung anbieten zu können, halte ich es für sinnvoller, über Möglichkeiten nachzudenken, die Verhandlungen von Urheberverbänden mit einzelnen Werknutzern und mögliche Analogiewirkungen befördern. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen können natürlich nicht bindend für ganze Branchen sein, aber zumindest aus dem Markt heraus Ansätze für denkbare Vergütungsregeln schaffen. Auch hier würde es schon helfen, das Ergebnis einer Schlichtung als zwingend zu gestalten. Dann könnten Urheberverbände einzelne marktmächtige Nutzer (etwa große Verlage) in Verhandlungen zwingen und zu verbindlichen Ergebnissen kommen. Es wäre viel gewonnen, wenn sich die Big Player an Vergütungsregeln halten müssten.
Diesbezüglich geht der zweite Vorschlag der Linken in die richtige Richtung. Auch hier ist fraglich, ob es das Justizministerium sein muss, welches entscheidet. Dass aber der Einigungsvorschlag einer Schlichtungsstelle für verbindlich erklärt werden kann, auch wenn ihm widersprochen wurde, halte ich für absolut richtig. Dies entsprach schon dem ursprünglichen Gedanken des sogenannten Professorenentwurfs aus dem Jahr 2000, welcher als erster Gesetzesentwurf die Reform des Urhebervertragsrechts angestoßen hatte und erstmalig die Idee von Gesamtverträgen formulierte. Denn schon damals war den Verfassern klar, dass es üblicherweise nicht ausreiche, Gesamtverträge nur zu ermöglichen. Aus diesem Grunde sollten zwingende Verfahrensvorschriften zu verbindlichen Ergebnissen führen.
Dass diese Idee im Zuge des erstes Korbes nicht durchgehalten wurde, ist bis heute ein riesiges, wenn nicht das größte Problem des Urhebervertragsrechts.
Christian Fehling (@luninbe) ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter des Tianda-Verlags.






Was sagen Sie dazu?