Leistungsschutzrechte schaden – auch den Verlagen
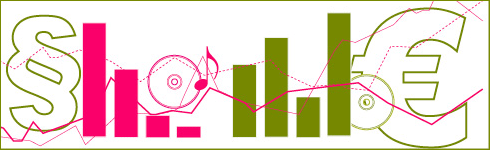
Es ist Montag, der 12. April 1982. Im Moot Courtroom der Jurafakultät der University of California at Berkeley beginnt der erste Tag der Anhörungen des Kongress-Unterausschusses zu Gerichten, Bürgerrechten und Rechtsregulierung. Das Thema: Privataufnahmen urheberrechtlich geschützter Werke. Der Anlass: Vor verschiedenen US-Gerichten streiten sich Universal City Studios und die Sony Corporation of America. Worüber? Über den Videorekorder.
Universal City Studios hatte Sony verklagt, weil sie es für einen Urheberrechtsverstoß hielten, wenn Privatpersonen urheberrechtlich geschützte Fernsehsendungen ohne Erlaubnis der Rechteinhaber aufnahmen. Der District Court, die untere Instanz, hatte gegen Universal entschieden und gesagt, es sei keine Urheberrechtsverletzung. Die Berufungsinstanz hatte das Urteil aufgehoben und den Fall an den District Court zurückverwiesen. Dann hatte Sony das höchste Gericht, den Supreme Court, um Klärung angerufen.
Nie zuvor hatte eine Auseinandersetzung über das Urheberrecht in den USA so viel Aufmerksamkeit erregt wie diese.
Als erster Sachverständiger tritt Jack Valenti vor die Kongressabgeordneten.
Jack Joseph Valenti. Italo-Amerikaner, ein Gesicht wie aus einem Martin-Scorsese-Film. Ehemaliger Bomberpilot, Harvard-Absolvent. Er war an Bord der Air Force One, als Lyndon Johnson nach dem Mord an John F. Kennedy seinen Amtseid ablegte. Er wurde Assistent von Präsident Johnson, wohnte mit ihm im Weißen Haus und war sein bester PR-Mann. Das Magazin American Spectator schrieb über Valenti:
“Hätte Lyndon Johnson die Wasserstoffbombe zum Einsatz gebracht – Valenti hätte das der Öffentlichkeit als Stadterneuerungsprogramm verkauft.”
Valenti wird später Mitglied der Französischen Ehrenlegion; die Jack J. Valenti School of Communication in Houston trägt seinen Namen.
Valenti war außerdem 38 Jahre lang Präsident der Motion Picture Association of America, des weltweit einflussreichsten Lobbyverbands der Filmindustrie – von 1966 bis 2004.
In dieser Funktion also tritt Valenti vor die Ausschussmitglieder, die ihn mit Vornamen anreden. In Los Angeles, quasi auf seinem Territorium, dem Herzen der amerikanischen – und damit der weltweiten – Filmwirtschaft.
Valenti brennt ein Feuerwerk von Zahlen und Statistiken ab, erklärt, dass der durchschnittliche US-Haushalt mit Videorekorder 28 Videokassetten besitzt, dass darauf 6.537.216 Filme im Jahr aufgenommen würden und dass, bei einem Preis von – man beachte die zurückhaltende Preiserwartung – 50 Dollar pro Film, wenn er als Aufnahme verkauft werden könnte, diese Filme einen Marktwert von 3,2 Milliarden Dollar hätten. Dass das Geld sei, das der US-Filmwirtschaft verloren gehe, in die Taschen japanischer Elektronikproduzenten fließe und die Filmindustrie ausbluten lasse – “bis zur Gehirnblutung”, wie er sich ausdrückt. Valenti hat es gern anschaulich.
Und dann sagt er den Satz. Den Valenti-Satz. Den Satz, der Jahrzehnte später noch zitiert wird. Weil er rhetorisch so unglaublich gut ist. Weil er die Skrupellosigkeit zeigt, mit der Valenti vorgeht, und mit der er fast immer ans Ziel kommt.
Weil er so anschaulich wie kein anderer zeigt, wie unfähig die Filmindustrie ist zu begreifen, welche Möglichkeiten die neue Technologie bietet.
“Der Videorekorder ist für den amerikanischen Filmproduzenten und die amerikanische Öffentlichkeit, was der Würger von Boston für die Frau allein zu haus ist.” – “The VCR is to the American film producer and the American public as the Boston strangler is to the woman home alone.” Ich denke, Sie können sich denken, was es mit dem Würger von Boston auf sich hat. 13 Frauen soll er auf dem Gewissen haben.
Der Videorekorder werde also der Boston Strangler der Filmindustrie werden. Niemand werde mehr ins Kino gehen, sobald man zu Hause Videos anschauen kann. Auch werde kein Werbekunde mehr Geld für Fernsehspots bezahlen, wenn Zuschauer das Programm aufnehmen und dann beim Abspielen die lästige Werbung einfach überspringen können. So Jack Valenti.
Deutschland ist nicht Amerika. Wir haben hier keinen Jack Valenti. Wir haben nur Christoph Keese.
Keese schreibt gut, ist eloquent, kann fehlerfrei “öffentliche Zugänglichmachung” sagen und Technik-Kompetenz simulieren, indem er mit Begriffen wie Automated Content Access Protokoll, Netzkomplexität und Abwärtskompatibilität jongliert. In Deutschland reicht das offensichtlich aus, um die Herzen von Polit-Visionären wie Günter Krings und Bernd Neumann zu erobern.
Das ist keine echte Überraschung bei Leuten, die den Unterschied zwischen Inhalt und Trägermedium nicht verstehen – oder aus strategischen Gründen nicht verstehen wollen – und daher Programme auflegen wie die “Nationale Initiative Printmedien – Zeitungen und Zeitschriften in der Demokratie”. Die finanzieren wir alle – mit unseren Steuern, mit den Kosten der Zeitungen und Magazine, die wir kaufen, mit Mitgliedsbeiträgen für Journalisten- und Verlegerverbände.
Nach eigener Aussage soll die Kampagne die “Medienkompetenz junger Leserinnen und Leser” fördern. Wissen Sie, was ich mir wünsche, seit diese Kampagne das erste Mal angekündigt wurde? Ich wünsche mir die “Nationale Initiative Zukunftsfähigkeit – Medienkompetenz und Internetnachhilfe im Deutschen Bundestag”. Ich wäre durchaus bereit, dafür den einen oder anderen Euro aus meinen Steuern und Mitgliedsbeiträgen springen zu lassen. Aber nur, wenn Anwesenheitslisten ausgefüllt und Tests zur Erfolgskontrolle gemacht werden.
Es scheint billig und naiv, auf diesen Dingen herum zu hacken. Wir wissen alle, dass Interessen dahinter stehen, wenn solche Kampagnen erdacht werden, dass es den Verlagen darum geht, ein herausragendes Geschäftsmodell zu erhalten, den betroffenen Politikern, sich lieb Kind bei den Verlagen zu machen. Wir sind selber bei einem Interessenverband zu Gast. Diese Veranstaltung hier ist – auch – eine Lobbying-Veranstaltung. Mit mir auf dem Podium werden gleich drei Interessenvertreter sitzen.
Wir alle wissen, dass Gesetze nicht nach rein rationalen Kriterien gemacht werden. Wir alle vermuten – einige von uns hoffen -, dass manche Akteure ihre Ahnungslosigkeit vortäuschen und als Werkzeug verwenden.
Doch all das hat Grenzen. Wir fürchten, dass die Ahnungslosigkeit vieler Politiker nicht gespielt ist; ich selber bin fest davon überzeugt, denn sonst wären in Land- und Bundestagen einige Oscars fällig. Wir akzeptieren, dass Politik nicht vollständig rational ist. Aber wir akzeptieren es nicht, wenn kein Funken Rationalität mehr darin vorkommt. Wir akzeptieren, dass Interessen existieren und vertreten werden, aber wir akzeptieren es nicht, wenn außer Interessen nichts mehr existiert oder eine Rolle spielt in der Politik.
Womit wir endlich beim Leistungsschutzrecht angelangt wären, dem Thema dieses Vortrags. Denn was der US-Filmindustrie der achtziger Jahre der Videorekorder, ist deutschen Verlagen im Jahr 2011 das Internet. Ich sage bewusst nicht “Suchmaschinen”, oder “Aggregatoren”, oder “Google”. Was Jack Valenti die Kopierabgabe für Videorekorder, ist Christoph Keese das Leistungsschutzrecht – und natürlich Mathias Döpfner und Hubert Burda, denn Keese ist ja nur der Frontmann.
Es ist der Versuch, eine Kontrolle über Inhalte auszuüben, die weder technisch sinnvoll, noch angemessen, noch zukunftsgewandt ist.
Einige von Ihnen werden sich jetzt vielleicht fragen: “Wann kommen denn endlich seine Argumente gegen das Leistungsschutzrecht?” Bitte sehr. Sie zu liefern, ist nicht besonders schwer. Ich habe sie kurzerhand kopiert aus einem Vortrag, den ich vor fast genau einem Jahr, am 28. April 2010, beim Publishers Forum in Berlin gehalten habe. Dort habe ich gesagt:
Ein Leistungsschutzrecht würde die Presse- und Ausdrucksfreiheit gefährden, das Zitatrecht einschränken, die Kommunikationsfreiheit im Internet behindern, freiberufliche Journalisten noch einmal schlechter stellen in ihrer Rechtsposition gegenüber den Verlagen. Es wäre ein neues Schutzrecht, von dem der Dortmunder Medienrechtler Udo Branahl sagt, dass es “ein Bruch mit sämtlichen kontinentalen Freiheitstraditionen” wäre.
Woher ich das alles weiß? Nun, ich weiß es nicht, denn mehr als eineinhalb Jahre, nachdem die Forderung das erste Mal aufgekommen ist, nachdem die Verlagslobbyisten es geschafft haben, der schwarz-gelben Regierung die Forderung nach einem solchen Recht in den Koalitionsvertrag zu diktieren, liegt kein Gesetzentwurf vor. Jeder unabhängige Urheberrechtler, den ich bisher gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, dass ein solches Schutzrecht keinen Kollateralschaden anrichten würde, hat das verneint. Und es waren viele. Solange die Verlage keinen Gesetzentwurf vorgelegt haben, an dem man ihre gebetsmühlenartigen Beschwichtigungsformeln überprüfen kann, dass schon alles in Ordnung sein werde mit dem neuen Recht, muss man vom Gegenteil ausgehen.
Zitat Ende.
Das war vor elf Monaten, das heißt, dass es jetzt zweieinhalb Jahre her ist, seit die Forderung das erste Mal aufkam. Ich werde meinen Text einfach so lang recyceln, bis ein Gesetzentwurf vorliegt. Insofern kann ich mich bei den Freunden des Leistungsschutzrechts nur dafür bedanken, dass sie es mir so leicht machen.
Und, meine Damen und Herren, jetzt verstehen Sie vielleicht auch besser, warum ich so lange auf der Meta-Ebene unterwegs war. Weil die Meta-Ebene die einzige ist, auf der man bisher sinnvoll diskutieren kann. Darüber, welches Problem das Leistungsschutzrecht lösen soll, und ob es gut ist, das mit einem Instrument zu tun, das der Urheberrechtsindustrie noch mehr Rechte einräumt und den Urhebern noch mehr Rechte nimmt.
Denn so viel steht fest: das Leistungsschutzrecht wäre ein Nullsummenspiel – wo den einen neue Rechte gewährt werden, müssen andere Rechte abtreten. Die anderen, das sind in diesem Fall wir alle.
Womit wir bei zwei wiederkehrenden Motiven in der Geschichte der Immaterialgüter angelangt sind, die uns heute die größten Probleme bereiten. Schutzrechte werden immer nur ausgeweitet, nie eingeschränkt, und es wird nie untersucht, ob sie etwas taugen, um ein vorliegendes Problem zu lösen – etwa durch empirische Analysen oder Modellierungen. Das Grundprinzip dieses rechtsdogmatischen Wiedergängers lautet: Wenn Schutz gut ist, muss mehr Schutz besser sein.
Die Frage ist nur: besser für wen? Die Antwort scheint auf der Hand zu liegen: Dem Inhaber des Schutzrechts nützt mehr Schutz. Der Gesellschaft schadet er wahrscheinlich.
Das wäre die übliche Frontstellung. Doch wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, geht es mir hier gar nicht um diesen Streit. Es geht mir darum zu fragen, ob die Verlage selbst gut beraten sind, ein Leistungsschutzrecht zu fordern.
Nochmal Jack Valenti: “Der Videorekorder ist für den amerikanischen Filmproduzenten und die amerikanische Öffentlichkeit, was der Würger von Boston für die Frau allein zuhaus ist.”
Der US Supreme Court hat sich von dieser Rhetorik nicht blenden lassen. Aber es war keine einfache Entscheidung. In der Wikipedia können Sie die faszinierende Geschichte davon nachlesen, wie es dazu gekommen ist, dass das Gericht mit 5 zu 4 Stimmen für Sony und gegen Universal entschieden hat.
Die verheerende Folge: der Videorekorder, der Boston Strangler der Studios, würgte der US-Filmwirtschaft die Luft ab. Filmfirmen machten reihenweise Pleite, Tausende Schauspieler standen auf der Straße, Clint Eastwood konnte keine Filme mehr drehen, Cinecitta und Bollywood übernahmen die Führung auf dem Weltmarkt. Hollywood ist heute nur noch ein Schatten seiner selbst. Jack Valenti wurde arbeitslos, verfiel dem Alkohol und wurde schließlich von der Polizei aufgegriffen, als er versuchte, mit seiner Schrotflinte ein Sony-Werbeplakat für einen Festplattenrekorder von einem Hausdach zu schießen.
Hoppla.
Einige von Ihnen werden das anders in Erinnerung haben. Und die Zahlen geben Ihnen Recht. Im Jahr 2001, knapp 20 Jahre nach Valentis Auftritt im Moot Courtroom, besaßen 93 Prozent aller US-Haushalte einen Videorekorder. Für dasselbe Jahr prognostizierte die Recording Media Association weltweite Verkäufe von mehr als 1,5 Milliarden bespielter Videokassetten. Wir reden hier von legalen, lizenzierten Videokassetten, die den Studios jährlich Milliarden Dollar in die Kassen spülten. Und die Einnahmen aus der Fernsehwerbung waren gegenüber den achtziger Jahren um ein Vielfaches gestiegen.
Valenti und die Filmbosse hätten eigentlich jeden Tag den Richtern des Supreme Court auf Knien für ihr Urteil danken müssen – um hier ein inzwischen recht populäres Motiv zu zitieren. Manchmal müssen Unternehmen offenbar vor sich selbst geschützt und dazu gezwungen werden, die Chancen neuer Entwicklungen zu ergreifen. Wer jetzt an das Vorgehen von FAZ und Süddeutscher Zeitung gegen Perlentaucher und Commentarist denkt, versteht, was ich meine.
Ob das hierzulande passiert und wer das übernimmt, wissen wir noch nicht. Die CDU ist natürlich ein hoffnungsloser Fall. Mir wäre es am liebsten, Frau Leutheusser-Schnarrenberger würde sich und ihre Partei davon überzeugen, dass das Leistungsschutzrecht ein zugleich wirtschafts- wie freiheitsfeindliches Unterfangen ist. Wenn sie das nicht tut, müssen wir auf den BGH hoffen. Aber das würde Jahre dauern und könnte in der Zwischenzeit einen enormen Schaden anrichten. Vor allem auch bei den Verlagen selber.
Doch die Einsichtsfähigkeit der ach so schutzlosen Umsatzmilliardäre wie Springer, Burda und Gruner & Jahr scheint arg begrenzt. Ganz zu schweigen von ihrem Unternehmergeist. Es ist schon ein elendes Schauspiel, sie dabei zu beobachten, wie sie in aller Öffentlichkeit beim Gesetzgeber um Hilfe betteln, als hinge ihr Überleben davon ab.
All das, um ein letztes Mal mit den Worten Jack Valentis zu sprechen, lässt einem erwachsenen Mann die Tränen in die Augen treten. Und Frauen auch, möchte ich heute hinzufügen.
Daher möchte ich Sie – und vor allem die Verleger – erinnern an einen Ausspruch dieses Genies mit dem seltsamen Namen, Buckminster Fuller. Man wird nichts ändern, indem man die existierende Realität bekämpft, so Fuller. Um etwas zu ändern, muss man ein neues Modell entwickeln, das das bestehende überflüssig macht.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.






Was sagen Sie dazu?