Ist der „Gebrauchthandel“ mit Nutzungsrechten erlaubt?
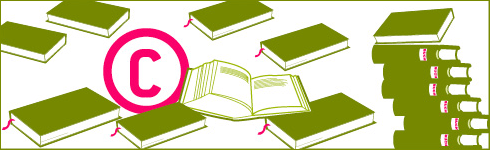
Was macht es für einen Unterschied, ob ich meine Software, mein Computerspiel oder mein Album auf einer CD kaufe oder sie mir entgeltlich aus dem Internet herunterlade? Ich bin der Käufer, also kann ich mein Eigentum auch weiter veräußern. Ob das stimmt, darüber streiten sich derzeit verschiedene Software-Konzerne vor deutschen Gerichten mit einem Anbieter von „gebrauchten“ Software-Lizenzen. Auch in Bezug auf Musik, Computerspiele und Filme stellt sich diese Frage zunehmend drängender. Denn der Markt mit digitalem Content wandelt sich: Der Verkauf von „körperlichen Produkten“ ist auf dem absteigenden Ast, während der „unkörperliche Vertrieb“, der auf dem Handel mit Nutzungsrechten basiert, zunimmt. Für den Nutzer, gleich ob Verbraucher oder Unternehmen, ist es daher von großer Bedeutung zu wissen, ob eine iTunes-Datei oder ein per Download erworbenes Computerprogramm einen Wiederverkaufswert hat oder nicht. Das ist nur der Fall, wenn das Urheberrecht die Weiterveräußerung gestattet.
Das Geschäft von Usedsoft
Zu „gebrauchten“ Software-Lizenzen sind im Jahr 2006 drei wichtige Entscheidungen deutscher Gerichte ergangen, die sich mit dem Angebot der Firma Usedsoft beschäftigen. In einem mittlerweile in zwei Instanzen entschiedenen Rechtsstreit vor Münchener Gerichten (Urteil des Landgerichts München I vom 19.1.2006, Aktenzeichen 7 O 23237/05, in erster Instanz; Urteil des Oberlandesgerichts München vom 3.8.2006, Aktenzeichen 6 U 1818/06 in zweiter Instanz) hatte die Firma Oracle gegen das findige Unternehmen gestritten. Vor dem Landgericht Hamburg bekam es Usedsoft mit einem “Fachhandelspartner” von Microsoft zu tun.
Worum geht es? Usedsoft handelt mit überschüssigen Volumenlizenzen. Diese werden von großen Softwareherstellern an Unternehmen vergeben, in denen das jeweilige Computerprogramm auf einer Vielzahl von Arbeitsplätzen genutzt wird. Es leuchtet ein, dass bei einem solchen Deal nicht hunderte von CD-ROMs an den Lizenznehmer geschickt werden. Vielmehr erwirbt das Unternehmen nur Nutzungsrechte, die benötigten Vervielfältigungsstücke (das kann auch nur ein einziges sein, wenn die Software allein auf einem Server installiert wird) werden bei Bedarf durch das Unternehmen selbst hergestellt.
Die Softwareanbieter eröffnen den Kunden diese Eigenversorgung mit den notwendigen Programmkopien auf unterschiedliche Art und Weise. Während Oracle seine Computerprogramme den berechtigten Unternehmen zum Download anbietet, stellt Microsoft eine einzige „Masterkopie“ der jeweiligen Software zur Verfügung. Diese soll von den Kunden dazu genutzt werden, das Programm auf ihren Rechnern so oft zu installieren, wie man Lizenzen erworben hat.
Es liegt auf der Hand, dass Software-Lizenzen für die Unternehmen einen erheblichen Wert darstellen, mit anderen Worten, dass hierin viel Geld investiert wird. Im Laufe der Zeit ändert sich häufig der Bedarf. Baut ein Unternehmen etwa Personal (und damit Computer-Arbeitsplätze) ab, sind die hierfür erworbenen Lizenzen überflüssig. Das gleiche passiert, wenn man auf eine andere Software umstellt (zum Beispiel auf Open-Source-Anwendungen) oder Arbeitsbereiche auslagert oder schließt. Werden einige oder alle Nutzungsrechte aufgrund solcher oder anderer Umstände nicht mehr gebraucht, möchte das Unternehmen die kostspielig erworbenen Lizenzen unter Umständen wieder zu Geld machen, indem es sie weiterverkauft.
Hier setzt nun das Geschäftsmodell von Usedsoft an. Das Unternehmen kauft überzählige Lizenzen ein und verkauft sie an andere Unternehmen weiter. Der ursprüngliche Inhaber der Nutzungsrechte versichert dabei, dass er seine Programmkopien vor dem Weiterverkauf (teilweise) löscht. Für die Kunden von Usedsoft ist das aus finanziellen Gründen interessant, denn sie können durch den „Gebrauchterwerb“ der Nutzungslizenzen Geld sparen. Nach Angaben von Usedsoft durchschnittlich 25 Prozent gegenüber dem Händler-Einkaufspreis für eine „neue“ Lizenz.
Weiterveräußerung von Nutzungsrechten nach deutschem Urheberrecht
Urheberrechtlich gesehen, ist die Frage, ob Usedsoft rechtmäßig handelt, nicht einfach zu beantworten. Das geltende Urheberrechtsgesetz regelt unmittelbar nur den Zweithandel mit „gebrauchten“ Produkten. Der so genannte Erschöpfungsgrundsatz besagt, dass ein Werkträger (also eine CD-ROM mit einem Computerprogramm oder eine CD mit Musik) jederzeit weiterverkauft werden darf, wenn er einmal mit Zustimmung des Rechteinhabers in Verkehr gebracht wurde. In dem Moment also, in dem ein Hersteller sein Produkt an einen Zwischen-, Groß- oder Einzelhändler abgibt oder an einen Endabnehmer veräußert, erlischt das urheberrechtliche Verbreitungsrecht. Was danach passiert, entzieht sich der Kontrollmöglichkeiten des Rechteinhabers.
Da sich jedoch der Erschöpfungsgrundsatz auf das Verbreitungsrecht und damit auf den Handel mit körperlichen Werkexemplaren beschränkt, ist die Frage, ob diese Grundregel auch auf unkörperliche Inhalte oder Lizenzen anwendbar ist, unter den Juristen äußerst umstritten. Aus dem deutschen Urheberrechtsgesetz ergibt sich keine Antwort. Die europäischen Rechtssetzungsinstitutionen haben sich dazu immerhin in einer vagen Formulierung in der so genannten „Information Society“-Richtlinie, auf der die deutsche Urheberrechtsreform des „Ersten Korbes“ basiert, geäußert. Diese Aussage legt zwar nahe, dass der Erschöpfungsgrundsatz bei unkörperlichen Werkexemplaren (also urheberrechtlich geschützten Inhalten, die per Download bezogen werden) nicht gelten soll. Eindeutig ist dies – angesichts der mehrdeutigen Aussage – jedoch nicht.
Was die Münchener Gerichte dazu sagen
Die Münchener Gerichte, die Oracle im einstweiligen Verfügungsverfahren gegen Usedsoft Recht gaben, sind der Ansicht, dass der Handel mit Lizenzen mit dem Handel von Produkten nicht gleichzusetzen sei. Die Bestimmungen in den Oracle-Lizenzverträgen, nach denen eine (vollständige oder teilweise) Weiterveräußerung von Volumen-Lizenzen untersagt wird, seien rechtmäßig. Das Gegenargument von Usedsoft, dass solche Volumen-Lizenzen die Erwerber unangemessen in ihren Eigentumsinteressen benachteiligten, ließ das Gericht nicht gelten. Auch der Einwand, die Käufer von Oracle-Software würden beim Online-Erwerb – entgegen der Grundgedanken des deutschen und europäischen Rechts – schlechter stehen als beim Produkterwerb, stieß bei den Münchener Richtern auf taube Ohren.
Vielmehr sei der Erschöpfungsgrundsatz in Bezug auf den Zweithandel mit Nutzungsrechten (Lizenzen) weder direkt noch analog anzuwenden. Ein solcher Handel wäre nur möglich, wenn der Hersteller dies in seinen Lizenzbestimmungen genehmigen würde. Da Oracle den Weiterverkauf jedoch ausdrücklich untersagt, seien deren Kunden nicht berechtigt, ihre Lizenzen an Usedsoft zu übertragen. Entsprechend könne Usedsoft sie auch nicht rechtswirksam weiterverkaufen. Usedsoft verleite insofern seine Kunden, rechtswidrige Programmkopien herzustellen und einzusetzen.
Nach der Interpretation des Landgerichts und des Oberlandesgerichts München erlaubt das geltende Recht den Gebrauchthandel von Nutzungsrechten nicht. Wollte man einen Zweitmarkt für das Wirtschaftsgut „Nutzungsrecht“ schaffen, müsste ihrer Ansicht nach das Gesetz geändert werden. Hätte diese Entscheidung Bestand, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf den Wiederverkauf von Content. Nicht nur in Bezug auf die Inhaber von Volumenlizenzen, sondern auch für die Kunden von iTunes oder Musicload, die ihre Musik und Videos bei Ebay versteigern wollen.
Dagegen: Das Landgericht Hamburg
Das Landgericht Hamburg hat in einer – vor dem Urteil des Oberlandesgerichts München ergangenen – Entscheidung allerdings die Gegenauffassung vertreten (Urteil vom 29.6.2006, Aktenzeichen 315 O 343/06). Die hierfür eingebrachten Argumente sind weniger formaljuristischer als praktischer Natur. Die Hamburger Richter halten den Erschöpfungsgrundsatz auf den Handel mit „gebrauchten“ Nutzungsrechten für entsprechend anwendbar. Wer eine Volumenlizenz erwerbe, schließe dabei mit dem Anbieter (in diesem Fall Microsoft) einen Kaufvertrag. „Das Verwertungsinteresse in Bezug auf Software unterscheidet sich indes nicht danach, ob die einzelnen Nutzungsrechte in Erfüllung des jeweiligen Volumenlizenzvertrages körperlich oder unkörperlich (…) übertragen werden“, heißt es in dem Urteil. Enthielten die Lizenzbestimmungen Übertragungsverbote, seien diese im Zweifel unwirksam. Denn der (hier entsprechend anwendbare) Erschöpfungsgrundsatz sei zwingend und könne vertraglich nicht umgangen werden.
Kurzum: Nach Meinung des Landgerichts Hamburg soll für den immer wichtiger werdenden Handel mit Nutzungsrechten das gleiche gelten wie für den Produkthandel. Weder können die Hersteller den Gebrauchthandel durch ihre Nutzungs- und Lizenzbestimmungen verbieten, noch ergibt sich ein solches Verbot aus dem geltenden Urheberrecht.
Weitere Aussichten
Das letzte Wort ist über das Thema längst nicht gesprochen. Noch ist über die Frage nicht rechtskräftig entschieden worden, im Zweifel wird der Bundesgerichtshof urteilen müssen. Ob es dann um gebrauchte Software oder Musikstücke, um Filme oder anderen digitalen Content geht, bleibt abzuwarten. So hat etwa der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) im Juli dieses Jahres iTunes unter anderem wegen einer Klausel in den Lizenzbestimmungen abgemahnt, die besagt, dass die in dem Musicstore erworbenen Musikdateien nicht weiterverkauft werden dürfen. Ob Apple dem nachkommt oder ob auch dieser Fall von den Gerichten entschieden wird, ist derzeit noch unklar.
Für Verbraucher wie Unternehmen wäre eine baldige Klärung wünschenswert. Denn solange in dieser Sache keine Rechtssicherheit hergestellt ist, ist das Eigentum an Dateien im Zweifel weniger wert als das an Produkten.






Was sagen Sie dazu?