Freie Lehr- und Lernmaterialien: Studie mit Bestandsaufnahme und Empfehlungen veröffentlicht

Mit der Studie „Open Education in Berlin: Benchmark und Potentiale“ (PDF) verfolgen ihre Urheber – Leonhard Dobusch, Maximilian Heimstädt und Jennifer Hill von der Management-Abteilung der Freien Universität Berlin – nach eigenen Aussagen das Ziel, konkrete Antworten auf eine Reihe von Fragestellungen zu geben, die sich mit dem Einsatz von „Open Educational Resources“ (OER) im Bildungswesen verbinden.
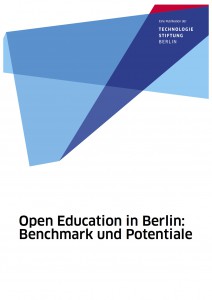 Ausgangspunkt ist dabei, dass freie OER-Bildungsmedien an die ältesten Bildungspraktiken schlechthin anknüpfen könnten: die „Weitergabe von Wissen zwischen Lehrenden und Lernenden sowie innerhalb dieser Gruppen“ und „Austausch von Lernmaterialien unter KollegInnen.“
Ausgangspunkt ist dabei, dass freie OER-Bildungsmedien an die ältesten Bildungspraktiken schlechthin anknüpfen könnten: die „Weitergabe von Wissen zwischen Lehrenden und Lernenden sowie innerhalb dieser Gruppen“ und „Austausch von Lernmaterialien unter KollegInnen.“
Doch da sämtliche Beteiligten im Bildungsbereich – Lehrkräfte, Schüler/innen und Studierende, Eltern, Bildungseinrichtungen und -träger, Verlage sowie Bildungspolitik und -verwaltung – mit OER bis zu einem gewissen Grad Neuland betreten würden, stellten sich pragmatische Fragen: Wo lässt sich ansetzen, um im oft unübersichtlichen und verschachtelten Kompetenzgeflecht von Schul- und Universitätsverwaltung (mehr) OER einzusetzen? „Was muss sich ändern, was sollte besser so bleiben, wie es ist? Wer ist in der Lage, einen Anfang zu machen?“
Nur ein Verlag antwortete
In ihrer Untersuchung legen die Wirtschaftswissenschaftler zwar einen Fokus auf die Situation in Berlin und beschränken sich auf die Schulen und Universitäten, gleichwohl solle die Studie auch einen Vergleich mit der Situation in anderen deutschen Bundesländern ermöglichen.
Hierfür befragten sie ein möglichst weites Spektrum von Akteurinnen und Akteuren an Berliner Schulen- und Hochschulen sowie in der Verwaltung. Von mehreren befragten Schulbuchverlagen und Bildungsmedienanbietern gab nur der Klett-Verlag Auskunft, dafür beteiligte sich Wikimedia mit Antworten, der Verein zur Förderung freien Wissens. Insgesamt führten die Forscher 19 persönliche und telefonische, leitfadengestützte Interviews, drei weiteren schriftliche Antworten flossen ein.
OER zunächst nicht billiger, sondern Investition
Als deren Ergebnis legt die Studie zuächst kurze Bestandsaufnahmen des Berliner Schulsystems sowie der Finanzierungsmethoden von Lernmitteln für schulische Bildung und Lehrerfortbildung vor, um darauf die Potenziale und Herausforderungen für OER in Berlin zu betrachten. Dazu heißt es in der Studie: „Der verstärkte Einsatz von OER an Schulen ist unweigerlich mit der Frage nach deren Finanzierung verbunden. Zumindest kurz- bis mittelfristig stellen OER keine Kostensparmaßnahme dar, sondern erfordern ebenso wie die Entwicklung herkömmlicher Materialien eine Investition.“
Gleichwohl habe es zur Integration von freien Lehr- und Lernmaterialien in das schulische Fortbildungssystem in den Interviews überwiegend positive Reaktionen gegeben. So hätten sich fast alle Befragten aus dem schulischen Bereich – mit Ausnahme des beruflichen Gymnasiums – dafür ausgesprochen, „das System der regionalen und schulinternen Fortbildungen zu nutzen, um Wissen über OER zu verbreiten und Lehrkräfte in deren Nutzung zu schulen.“
Um Open Educational Resources in die Berliner Schullandschaft zu integrieren, bringen die Autoren eine zentrale, digitale Plattform ins Spiel, auf welcher OER-Materialien angeboten, gefunden und ausgetauscht werden können. Im Hochschulbereich befragten die FU-Wissenschaftler gezielt Mitarbeiter aus den jeweiligen Computer- und Medienzentren über Lehrbücher, Foliensätze, Begleitmaterialien, didaktische Konzepte und Lehrvideos, nicht über wissenschaftliche Veröffentlichungen im engeren Sinne.
Handlungsempfehlungen für OER in Schulen
In einer Art Quintessenz formuliert die Studie Handlungsempfehlungen für den Einsatz von OER in Schulen und Hochschulen, die in Szenarien erläutert werden.
Szenario: „Graswurzeln düngen“
- Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend Wissenschaft erstellt eine Deinition von OER und signalisiert, dass der OER-Einsatz allgemein erwünscht ist.
- Ein Wettbewerb zur Erstellung von OER durch einzelne Lehrkräfte oder Kleingruppen wird einberufen. Die erstellten Lernmaterialien werden auf dem Bildungsserver gesammelt und bereitgestellt.
- OER wird als ein Fokusthema für Lehrkräftefortbildungen benannt. Lehrkräfte werden darin geschult, OER zu verbreiten und zu erstellen
- Schulen werden aufgefordert, OER-Ansprechpartner/innen zu benennen, die im Rahmen von zentralen Schulungen weitergebildet werden.
Szenario: „OER-Mainstreaming“
- Die Handlungsempfehlungen von Szenario 1 bilden die Grundlage für Szenario 2 und werden vorausgesetzt.
- In einem Pilotprojekt werden lehrplankonforme OER-Lernmittel für ein naturwissenschaftlich-technisches Fach der Mittelstufe entwickelt. Die konkrete Umsetzung – in Form von Büchern, Lernmodulen mit Online- und Offline-Elementen oder Arbeitsblattsammlungen – verbleibt in der Verantwortung der jeweiligen Anbieter von OER-Lernmitteln.
- Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend Wissenschaft legt einen Kriterienkatalog für OER-Lernmittel fest und prüft Konzepte und Kosten potenzieller Anbieter hinsichtlich prinzipieller Zertifizierbarkeit.
- Die Angebote enthalten Kostenbeiträge pro Schüler/in sowie eine Mindestzahl an Beiträgen, um die Erstellung zu finanzieren. Kommt das Geld nicht zusammen, werden herkömmliche Schulbücher erworben. Schulen bestimmen demnach wie bisher intern und autonom, ob sie ihr Budget auf die Erstellung von OER verwenden. Parallel zu klassischen Anschaffungen könnte auch ein OER-Lernmittelfonds aufgelegt werden.
- In Folgejahren können die bestehenden Bücher mit geringerem Finanzaufwand aktualisiert werden. Aktualisierungsangebote werden genauso wie Angebote zur Neuerstellung mit Mindestfinanzierungssummen ausgeschrieben.
Szenario: „Vorrang für OER“
- Es wird eine „Stabsstelle OER“ in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend Wissenschaft eingerichtet, die Expertise sammelt, Förderprogramme ausarbeitet und betreut und OER-Aktivitäten koordiniert.
- OER-Unterstützung in vorhandenen Lehr- und Lernplattformen wie Moodle oder Blackboard wird gefördert.
- Dezentral erstellte OER werden erfasst und leichter zugänglich gemacht
- Schulen, die sich an der Erstellung von OER-Lernmitteln und den Kosten beteiligen, bekommen einen OER-Bonus in Höhe von 15-25 Prozent und damit einen finanziellen Anreiz.
Handlungsempfehlungen für OER in Hochschulen
- Förderprogramme für OER-Lehre nach internationalen nationalen Vorbildern werden aufgesetzt.
- Die OER-Unterstützung in vorhandene Lernplattformen wird gefördert.
- Informationen über OER werden in die hochschuldidaktische Bildung integriert.
- Eine Stelle für OER im Hochschulbereich beim Senat wird geschaffen und Universitäten aufgefordert, klare Zuständigkeiten für OER-Angelegenheiten zu schaffen.
In den allgemeine Handlungsempfehlungen unterstützen die Autoren zudem die Forderung, eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke einzuführen. Die Studie wurde von der Technologiestiftung Berlin beauftragt und finanziell sowie logistisch unterstützt, einer mit Mitteln des Landes Berlin geförderten und von der EU kofinanzierten [landeseigenen] Einrichtung. Die darin aufgeführten Datenerhebungen im Rahmen des Projekts „Digitaler Offenheitsindex“ wurden von der Internetprivatstiftung Austria sowie Wikimedia Deutschland finanziell unterstützt.







6 Kommentare
1 John am 16. Mai, 2014 um 15:10
Hallo,
ich bin durch Zufall auf diese Beitrag gestossen. Dieser Artikel ist sehr gut und ausführlich.
Ich habe noch einen Tip zum Thema
„Open Educational Resources“ (OER)
Die Leuphana Digital School der Leuphana Universität Lüneburg startet am 20. Mai 2014 einen neuen MOOC zum Thema
„Psychology of Negotiations – Reaching Sustainable Agreements in Negotiations on „Commons”.
[gekürzt, bitte unsere Regeln zu werbenden Kommentaren beachten, d. Red.]
2 Henry Steinhau am 16. Mai, 2014 um 15:13
Danke für den Hinweis, das war von uns nicht gut formuliert, wir haben es verbessert.
3 Dieter Müller am 16. Mai, 2014 um 15:15
Danke für den ausführlichen Bericht über unsere Studie – an einer Stelle muss ich jedoch korrigieren: Die Technologiestiftung Berlin ist eine privatrechtliche Stiftung und keine landeseigene Einrichtung!
Dr. Dieter Müller
Technologiestiftung Berlin
4 Florian Sänger am 28. September, 2014 um 17:20
@Henry Steinhau:
Leider scheint das PDF zur Studie nicht mehr unter dem angegebenen Link zu existieren.
Außerdem stimmt mit dem Link “Open Education Resources Studie vorgestellt” etwas nicht – der führt aktuell auch ins Leere.
5 Florian Sänger am 28. September, 2014 um 17:21
Ergänzung: Die Studie ist hier zu finden:
http://www.technologiestiftung-berlin.de/fileadmin/daten/media/publikationen/140514_Studie_OER.pdf
6 Henry Steinhau am 1. Oktober, 2014 um 13:33
@ Florian Sänger: Vielen Dank für die Hinweise, wir haben den betreffenden Link aktualisiert.
Was sagen Sie dazu?